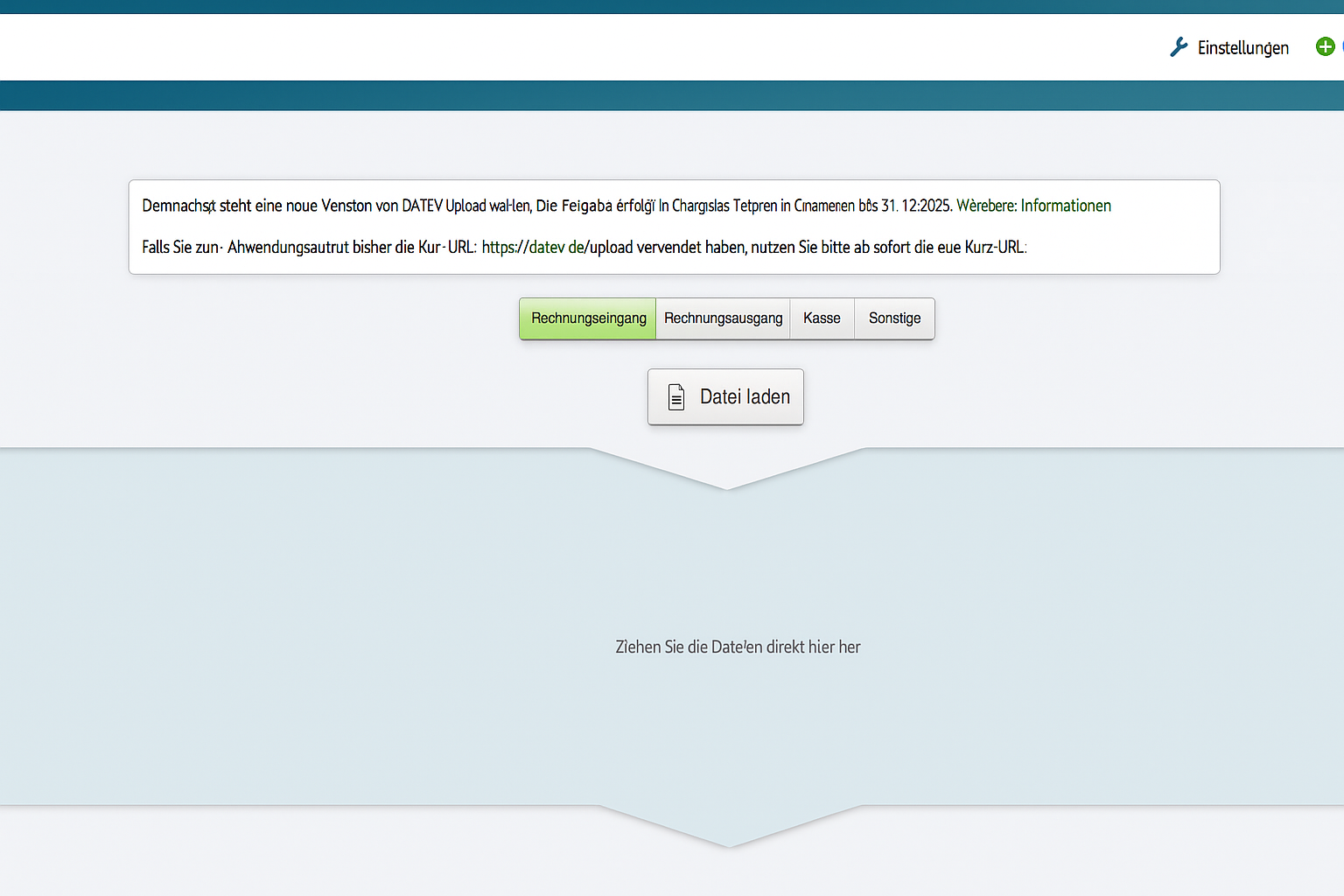📘 Mandanten-Wiki – Suche
Finde schnell Antworten und Erklärartikel. Nutze Suche, Kategorie-Filter und Sortierung.
§ 15a EStG – VERLUSTVERRECHNUNG BEI KOMMANDITISTEN
WIKI: § 15a EStG – VERLUSTVERRECHNUNG BEI KOMMANDITISTEN
Wann Verluste steuerlich nutzbar sind – und wann nicht.
Kurzfazit
- § 15a EStG beschränkt die Verlustverrechnung für Kommanditisten.
- Verluste dürfen nur bis zur Höhe der Haftungssumme + Einlage verrechnet werden.
- Darüber hinausgehende Verluste = verrechenbare Verluste → spätere Nutzung möglich.
💡 Zur schnellen Berechnung nutze den
§ 15a EStG-Rechner.
Grundprinzip
- Haftung: Kommanditist haftet nur mit Einlage + Hafteinlage.
- Steuerlich: Verluste können nur mit steuerlich „haftendem Kapital“ verrechnet werden.
- Geht das Kapitalkonto ins Minus → Verluste „gesperrt“ (§ 15a EStG).
Praxis-Beispiele
Beispiel 1: Einlage gedeckt
Einlage 10.000 € – Verlustanteil 8.000 € → voll verrechenbar.
Beispiel 2: Über Einlage hinaus
Einlage 10.000 € – Verlustanteil 15.000 € → 10.000 € sofort nutzbar, 5.000 € gesperrt.
Beispiel 3: Spätere Nutzung
Die „gesperrten“ 5.000 € können genutzt werden, sobald das Kapitalkonto durch Gewinne wieder positiv wird.
Checkliste für Kommanditisten
👉 Mit dem § 15a EStG-Rechner kannst du sofort berechnen,
welcher Teil deines Verlustes nutzbar ist und welcher gesperrt bleibt.
Typische Fehler
- Verluste sofort angesetzt, obwohl Kapitalkonto ins Minus geht.
- Keine Trennung von nutzbaren und gesperrten Verlusten in der Erklärung.
- Fehlende Dokumentation der Haftsumme → Probleme bei BP.
FAQ zu § 15a EStG
Gilt § 15a nur für Kommanditisten?
Ja, betroffen sind Kommanditisten und ähnliche Gesellschafter (z. B. bei GmbH & Co. KG). Vollhaftende Gesellschafter nicht.
Was sind „verrechenbare Verluste“?
Das sind Verluste, die gesperrt sind, aber steuerlich vorgemerkt bleiben. Sie können später genutzt werden.
Wie lange kann ich die Verluste vortragen?
Unbegrenzt – bis sie durch künftige Gewinne „freigeschaltet“ werden.
§ 15a UStG – VORSTEUERBERICHTIGUNG BEI NUTZUNGSÄNDERUNG
WIKI: § 15a UStG – VORSTEUERBERICHTIGUNG BEI NUTZUNGSÄNDERUNG
Wann du bereits gezogene Vorsteuer anteilig zurückzahlen (oder zusätzlich ziehen) musst – inkl. Rechner-Hinweis.
Kurzfazit
- § 15a UStG korrigiert Vorsteuer, wenn sich die Nutzung eines WG später ändert (steuerpflichtig ↔ steuerfrei / unternehmerisch ↔ privat).
- Berichtigungszeitraum: 5 Jahre (bewegliche WG) / 10 Jahre (Grundstücke/Immobilien).
- Korrektur = ursprünglicher Vorsteuerbetrag × (Restlaufzeit / Gesamtzeitraum).
💡 Schnellrechner: § 15a UStG-Rechner – Berichtigungsbetrag in Sekunden ermitteln.
Wann greift § 15a UStG?
- Nutzungsänderung: z. B. Laptop/Auto erst 100 % betrieblich, später teilweise privat.
- Wechsel der Umsätze: von steuerpflichtig zu steuerfrei (oder umgekehrt).
- Veräußerung/Entnahme im Berichtigungszeitraum.
- Investitionen in Immobilien (Mietobjekte) mit geänderter Vermietung (steuerpflichtig ↔ steuerfrei).
Nicht relevant für Kleinunternehmer ohne Vorsteuerabzug.
Berichtigungszeiträume & Berechnung
| Wirtschaftsgut | Zeitraum | Jährlicher Korrekturschlüssel |
|---|---|---|
| Bewegliche WG (Maschinen, PKW, IT) | 5 Jahre | 1/5 der Vorsteuer p. a. |
| Grundstücke/Immobilien | 10 Jahre | 1/10 der Vorsteuer p. a. |
Formel (vereinfachte Logik): Berichtigung = Urspr. Vorsteuer × (verbleibende Jahre / Gesamtjahre) × Nutzungsänderungsquote.
Bei Teiländerungen (z. B. 60 % → 30 % unternehmerisch) wird nur die Differenzquote korrigiert (30 %-Punkte).
Praxis-Beispiele
Beispiel 1 – Laptop (5 Jahre)
Vorsteuer 380 €. Nach 2 Jahren nur noch halb betrieblich (100 % → 50 %).
Restjahre: 3 → 380 × (3/5) × 50 % = 114 € ans FA zurück.
Beispiel 2 – Vermietung (10 Jahre)
Sanierungsvorsteuer 19.000 €. Nach 4 Jahren Wechsel zu steuerfreier Vermietung.
Restjahre: 6 → 19.000 × (6/10) = 11.400 € zurück.
Beispiel 3 – Upgrade
Aus privat/steuerfrei wird steuerpflichtig: Gutschrift der Vorsteuer im Umfang der Restlaufzeit.
Checkliste: So gehst du vor
👉 Direkt rechnen mit dem § 15a UStG-Rechner – Ergebnis als Doku abspeichern.
Typische Fehler
- Berichtigung vergessen bei Wechsel der Vermietung (steuerpflichtig ↔ steuerfrei).
- Falscher Zeitraum (5 statt 10 Jahre oder umgekehrt).
- Keine Quoten-Doku bei gemischt genutzten WG.
- Veräußerung im Zeitraum ohne Restlaufzeit-Berechnung.
FAQ zu § 15a UStG
Gilt § 15a auch für geringwertige WG?
Ja, wenn sie dem Anlagevermögen zugeordnet sind und im Berichtigungszeitraum eine Nutzungsänderung eintritt.
Was, wenn ich Kleinunternehmer werde?
Wechsel zum Kleinunternehmer kann eine Berichtigung auslösen (kein Vorsteuerabzug mehr).
Wie dokumentiere ich die Quote?
Z. B. Fahrtenbuch, Raumaufteilung, Zeit-/Nutzungsnachweise, Mietverträge – prüffest ablegen.
§ 37b EStG – PAUSCHALBESTEUERUNG VON SACHZUWENDUNGEN
WIKI: § 37b EStG – PAUSCHALBESTEUERUNG VON SACHZUWENDUNGEN
Geschenke, Incentives & Events pauschal mit 30 % versteuern – so funktioniert’s.
Kurzfazit
- § 37b erlaubt, Sachzuwendungen an Kunden & Geschäftspartner (Abs. 1) sowie an Arbeitnehmer (Abs. 2) pauschal mit 30 % LSt zu besteuern.
- Vorteil: Empfänger hat keine Steuerlast; Arbeitgeber trägt die Pauschalsteuer.
- Grenze: bis 10.000 € je Empfänger/Jahr anwendbar; sonst keine Pauschalierung.
💡 Ideal für Präsente, Incentives, Events – aber Dokumentation ist Pflicht.
Begünstigte Zuwendungen
- Sachzuwendungen (Waren, Gutscheine i. S. d. Sachbezug, Einladungen zu Events/Restaurants, Reisen).
- Keine Pauschalierung für Geldleistungen (reine Barzahlungen).
- USt-Hinweis: Zuwendung kann eine unentgeltliche Wertabgabe sein → USt berücksichtigen.
Praxisbeispiele
Kundengeschenk
Weihnachtspaket (150 € netto) für Key Accounts → § 37b anwenden; Empfänger steuerfrei, AG trägt 30 % LSt (+ Soli/KiSt).
Incentive-Event
Top-Kunden zum Konzert eingeladen → pauschalieren nach § 37b; 10.000 €-Grenze je Empfänger im Blick.
Mitarbeiter-Incentive
Wochenendtrip fürs Sales-Team → Arbeitgeber kann Abs. 2 anwenden statt individuellen Arbeitslohns.
Beispielrechnungen: Kosten all-in
| Wert der Zuwendung (brutto) | Pauschalsteuer 30 % | Soli (5,5 %) | KiSt (9 %) | Gesamtkosten AG |
|---|---|---|---|---|
| 100 € | 30,00 € | 1,65 € | 2,70 € | 134,35 € |
| 500 € | 150,00 € | 8,25 € | 13,50 € | 671,75 € |
| 1.000 € | 300,00 € | 16,50 € | 27,00 € | 1.343,50 € |
💡 Angenommen: Kirchensteuerpflicht (9 %) liegt vor. Ohne KiSt sind die Gesamtkosten etwas niedriger.
Umsetzung & Wahlrecht
- Einheitliches Wahlrecht je Wirtschaftsjahr für alle gleichartigen Zuwendungen (kein „Cherry Picking“).
- Bemessungsgrundlage: Bruttowert inkl. USt (falls angefallen) + Nebenleistungen.
- Zusätzlich zur 30 % LSt kommen Soli und ggf. KiSt.
- Dokumentation: Empfängerkreis, Anlass, Werte; Nachweis für BP.
- Geschenkeabzugsverbot (35 € netto/Jahr) bei Betriebsausgaben beachten – § 37b ändert nicht die Abziehbarkeit.
Checkliste vor Anwendung von § 37b
FAQ
Gilt § 37b auch für Mitarbeiter?
Ja, Abs. 2 ermöglicht die Pauschalierung beim Arbeitslohn für Sachzuwendungen (z. B. Incentives).
Wie wirkt sich § 37b auf die SV aus?
Pauschalierte Zuwendungen sind regelmäßig SV-frei, da nicht dem individuellen Arbeitslohn zugerechnet.
Muss ich Kirchensteuer mit abführen?
Ja, falls kirchensteuerpflichtig – wird auf die 30 % LSt aufgeschlagen.
37b-Rechner
10 Steuerfallen für Onlinehändler
WIKI: 10 STEUERFALLEN FÜR ONLINEHÄNDLER – UND WIE DU SIE VERMEIDEST
Die größten Risiken im eCommerce – als Checkliste zum Abhaken.
Kurzfazit
- Onlinehandel = hohes Risiko für Steuerfallen (grenzüberschreitend, digital, Marktplätze).
- Die 10 häufigsten Fehler lassen sich mit klaren Prozessen vermeiden.
- Checkliste regelmäßig durchgehen → spart Ärger bei Betriebsprüfungen.
Die 10 Steuerfallen im Überblick
Tipp: Nutze für die Umsatzsteuerberechnung den OSS-Rechner.
Praxis-Tipps zur Vermeidung
✅ Prozesse
- Monatliches Steuer-Review.
- Verantwortlichkeiten klar festlegen (Shop, Buchhaltung, Steuerberater).
✅ Technik
- Shop/ERP mit richtigen Steuersätzen pro Land konfigurieren.
- Automatische VIES-Prüfung der USt-IdNr. einbauen.
✅ Dokumentation
- Alle Abfragen/Nachweise digital archivieren.
- Checkliste quartalsweise abhaken.
Top 5 Quick Wins – sofort umsetzbar
✅ OSS anmelden
Wenn die 10.000 €-Schwelle überschritten ist → sofort im BZSt-Portal registrieren.
📄 Rechnungen prüfen
Pflichtangaben + Reverse-Charge-/Steuerfrei-Hinweise ergänzen.
🔍 VIES-Check
Alle USt-IdNrn. von B2B-Kunden prüfen & Nachweise speichern.
🌍 Steuersätze kontrollieren
Shop-System für die wichtigsten EU-Länder korrekt einstellen (DE 19 %, NL 21 %, FR 20 % …).
📦 Doku vorbereiten
Alle Versand- & Rechnungsnachweise zentral ablegen → ready für Betriebsprüfung.
Mit diesen 5 Schritten reduzierst du sofort das Risiko teurer Fehler.
FAQ: häufige Fragen
Kann ich die Steuerfallen komplett vermeiden?
Fehler können passieren – aber mit Checklisten & klaren Prozessen lässt sich das Risiko stark reduzieren.
Muss ich OSS nutzen?
Ja, wenn die 10.000 €-Schwelle überschritten wird und du B2C-Umsätze in mehrere EU-Länder hast.
Reicht es, wenn mein Steuerberater das prüft?
Dein Steuerberater braucht saubere Daten & Belege. Prozesse im Unternehmen sind die Grundlage.
Abfindungen & Fünftelregelung
Abfindungen & Fünftelregelung
Abfindungen entstehen häufig bei Kündigungen oder Aufhebungsverträgen.
Sie sind grundsätzlich steuerpflichtig, können aber durch die Fünftelregelung steuerlich begünstigt werden.
Ziel: die Progressionswirkung einer einmaligen Zahlung abzumildern.
1. Steuerliche Behandlung von Abfindungen
- Abfindungen zählen zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit (§ 34 EStG).
- Sie sind lohnsteuerpflichtig, aber in der Regel sozialversicherungsfrei – vorausgesetzt, die Zahlung erfolgt wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
- Eine begünstigte Auszahlung muss grundsätzlich zusammengeballt erfolgen (in einem Kalenderjahr).
2. Die Fünftelregelung
- Die Abfindung wird rechnerisch in fünf Teile aufgeteilt.
- Nur ein Fünftel wird dem Jahreseinkommen zugerechnet → Steuerberechnung.
- Die Steuer wird anschließend mit und ohne Abfindung verglichen – die Differenz × 5 ergibt die Steuerlast.
- Dadurch sinkt die Progression, insbesondere bei hohen Einmalzahlungen.
3. Voraussetzungen für die Begünstigung
- Abfindung wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses (Kündigung / Aufhebungsvertrag).
- Zusammenballung der Einkünfte: Auszahlung überwiegend in einem Kalenderjahr.
- Keine Anwendung, wenn Abfindung auf mehrere Jahre verteilt wird (Ausnahme: kleine Restzahlungen).
4. Beispielrechnung
Arbeitnehmer erhält im Jahr 2025 ein reguläres Einkommen von 40.000 € und eine Abfindung von 50.000 €.
- Normale Besteuerung: Steuer auf 90.000 € Einkommen.
- Mit Fünftelregelung: Steuer auf 40.000 € + 10.000 € (= 1/5 der Abfindung).
Differenz zur Steuer ohne Abfindung wird ×5 gerechnet. - Ergebnis: Die Steuerlast auf die Abfindung sinkt deutlich.
5. Tipps & Hinweise
- Auszahlungszeitpunkt sorgfältig planen – Verschiebung ins Folgejahr kann Steuern sparen.
- Weitere Einmalzahlungen (z. B. Boni) besser in andere Jahre legen.
- Abfindung ggf. in eine betriebliche Altersvorsorge (bAV) einzahlen → steuerlich vorteilhaft.
- Bei sehr niedrigem Einkommen im Abfindungsjahr kann die Fünftelregelung weniger vorteilhaft sein.
- Steuerberater einbinden, um die optimale Gestaltung individuell zu prüfen.
Abfindungen – schnelle Orientierung
- Abfindungen steuerpflichtig, aber meist sozialversicherungsfrei
- Fünftelregelung mildert Progressionseffekt
- Wichtig: Auszahlung in einem Jahr („Zusammenballung“)
- Gestaltung über bAV oder Terminverschiebung prüfen
Hinweis: Diese Übersicht ersetzt keine individuelle Steuerberatung.
Gestaltungsmöglichkeiten sollten frühzeitig geprüft werden.
Altersvorsorge in Deutschland
Altersvorsorge – welche Wege gibt es?
Die Altersvorsorge in Deutschland beruht auf dem 3-Säulen-Modell:
gesetzliche Rente, private Vorsorge und betriebliche Vorsorge.
Je nach Modell gibt es staatliche Förderung und steuerliche Vorteile.
1) Gesetzliche Rente
- Pflicht für Arbeitnehmer – Umlageverfahren (aktuelle Beitragszahler finanzieren aktuelle Rentner).
- Höhe richtet sich nach Entgeltpunkten (Beiträge × Jahre × Durchschnittseinkommen).
- Risiko: Demografie → weniger Beitragszahler, mehr Rentner.
2) Private Vorsorge
- Riester-Rente: Staatliche Zulagen + Steuerersparnis, aber komplex & oft geringe Rendite.
- Rürup-Rente (Basisrente): hohe steuerliche Absetzbarkeit, v. a. für Selbstständige interessant.
- Private Rentenversicherung / Fonds: flexible Anlage, keine staatliche Förderung, aber volle Kontrolle.
3) Betriebliche Altersvorsorge (bAV)
- Arbeitgeber bietet Modelle wie Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds.
- Steuer- & Sozialabgabenfreiheit der Beiträge bis zu bestimmten Höchstgrenzen.
- Seit 2019 Pflicht-Arbeitgeberzuschuss (i. d. R. 15 %).
4) Vergleich auf einen Blick
- Riester: gut für Familien mit Kindern (hohe Zulagen), aber unflexibel.
- Rürup: ideal für Selbstständige/Freiberufler mit hohem Einkommen.
- bAV: Vorteil durch Steuer- & Sozialabgabenersparnis, Bindung an Arbeitgeber beachten.
- Private Fonds/Sparpläne: flexibel, oft höhere Renditechancen, aber keine Förderung.
5) Tipps für die Praxis
- Früh beginnen: Zinseszins wirkt über Jahrzehnte.
- Kombination wählen: staatliche Förderung + flexible Anlagen.
- Steuerliche Vorteile prüfen: v. a. Rürup (Basisrente) kann Einkommensteuer deutlich senken.
Altersvorsorgeaufwendungen
Altersvorsorgeaufwendungen
Altersvorsorgeaufwendungen sind Beiträge zur Absicherung im Alter.
Dazu gehören die gesetzliche Rentenversicherung, die Rürup- (Basisrente) und Riester-Rente.
Sie sind steuerlich begünstigt – die spätere Auszahlung unterliegt jedoch der Besteuerung
(nachgelagerte Besteuerung).
1. Gesetzliche Rentenversicherung
- Pflichtbeiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern.
- Ab 2025: 100 % der Beiträge steuerlich abzugsfähig.
- Beiträge zählen zur sogenannten Basisversorgung.
- Spätere Rentenzahlungen → steuerpflichtig (Besteuerungsanteil abhängig vom Rentenbeginn).
2. Rürup-Rente (Basisrente)
- Besonders geeignet für Selbstständige, Freiberufler & Gutverdiener.
- Sehr hohe steuerliche Förderung:
– Ab 2025 sind 100 % der Beiträge absetzbar.
– Maximal abzugsfähiger Beitrag 2025: ca. 27.500 € pro Person (Verheiratete: ca. 55.000 €). - Beiträge mindern direkt das zu versteuernde Einkommen → oft spürbare Steuerersparnis.
- Auszahlung nur als lebenslange Rente, kein Kapitalwahlrecht.
- Besteuerung in der Rentenphase: nachgelagert, Anteil steigt bis 2040 auf 100 %.
3. Riester-Rente
- Förderung durch Zulagen (175 € Grundzulage + Kinderzulagen).
- Zusätzlich Sonderausgabenabzug bis max. 2.100 €.
- Geeignet vor allem für Familien mit Kindern und Arbeitnehmer in der GKV.
- Auszahlungen → steuerpflichtig (nachgelagerte Besteuerung), bis zu 30 % Kapitalentnahme möglich.
4. Steuerliche Aspekte
- Beiträge: senken die Steuerlast (Sonderausgaben).
- Auszahlungen: nachgelagerte Besteuerung (Renten voll steuerpflichtig ab 2040).
- Die Steuerersparnis in der Einzahlungsphase kann erheblich sein, insbesondere bei hohen Einkommen.
- Strategisch nutzen: Beiträge in guten Jahren (hohes Einkommen, hohe Steuerprogression) besonders vorteilhaft.
5. Tipps & Hinweise
- Rürup eignet sich zur Steueroptimierung – vor allem für Selbstständige.
- Riester lohnt sich häufig bei Kindern und geringeren Einkommen.
- Auszahlungsphase bedenken: Renten sind steuerpflichtig, Freibeträge prüfen.
- Eine Kombination mit betrieblicher Altersvorsorge kann sinnvoll sein.
Altersvorsorgeaufwendungen – schnelle Orientierung
- Gesetzliche Rente: Pflichtbeiträge, steuerlich absetzbar
- Rürup-Rente: bis 27.500 € p.a. (ab 2025) voll absetzbar
- Riester-Rente: Zulagen + bis 2.100 € Sonderausgabenabzug
- Auszahlungen: nachgelagerte Besteuerung
Hinweis: Diese Übersicht ersetzt keine individuelle Beratung.
Besonders die Steuerersparnis durch Rürup sollte individuell berechnet werden.
Arbeitsmittel
💻 Arbeitsmittel & Computer (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 EStG)
Kanzlei-Wiki • Stand: Oktober 2025
Arbeitsmittel sind Gegenstände, die unmittelbar der beruflichen Tätigkeit dienen (z. B. Laptop, Monitor, Fachliteratur, Werkzeug). Bei Arbeitnehmer:innen sind sie als Werbungskosten abziehbar, bei Selbstständigen als Betriebsausgaben.
§ 6 Abs. 2 EStG (GWG)
AfA/ND: amtliche AfA-Tabellen
Abzug nur, soweit berufliche Nutzung vorliegt. Private Nutzung → anteilige Kürzung (Ausnahme: untergeordnet < 10 % privat → i. d. R. voller Abzug).
| Fall | Behandlung | Praxis |
|---|---|---|
| Kleinteile (geringfügig, z. B. Maus, Tasche) | Sofort | Beleg sammeln, direkt als Werbungskosten |
| GWG bis 800 € netto (952 € brutto) | Sofortabschreibung | Einzeln nutzbar & zuordenbar; keine AfA nötig |
| Sammlung/Pool (z. B. Set aus Monitor+Dock) | Einzelfall | Wenn nur zusammen nutzbar → ggf. einheitliches WG (GWG-Prüfung) |
| Anschaffung > 952 € brutto | AfA über ND | Zerlegung auf Nutzungsdauer (z. B. 3–5 Jahre) |
Für Arbeitnehmer:innen gilt die GWG-Logik analog; maßgeblich ist der berufliche Nutzungsanteil.
Für Computerhardware & -software wird in der Praxis häufig eine kurze Nutzungsdauer (i. d. R. 1 Jahr) angesetzt. Dadurch ist ein voller Aufwand im Anschaffungsjahr möglich (zeitanteilig bei Erwerb im laufenden Jahr).
| Gegenstand | Typische ND | Behandlung |
|---|---|---|
| Laptop/PC, Tablet | ≈ 1 Jahr | Voller Abzug im Jahr |
| Software-Lizenzen (Abo) | vertragsabhängig | laufender Aufwand |
| Monitore, Docking, Drucker | 2–5 Jahre | AfA oder GWG je nach Preis |
Bei gemischter Nutzung: Aufteilung nach plausibler Quote (z. B. 70 % beruflich / 30 % privat).
| Beruflicher Anteil | Abzug | Hinweis |
|---|---|---|
| ≥ 90 % beruflich (private Nutzung untergeordnet) | 100 % | Voller Ansatz zulässig |
| 10–90 % beruflich | anteilig | Quote dokumentieren (Nutzungsprotokoll/Begründung) |
| < 10 % beruflich | kein Abzug | Überwiegend privat → nicht abzugsfähig |
Praxis: Eine konservative, nachvollziehbare Schätzung genügt – ideal mit kurzer schriftlicher Begründung.
- Überlassener Firmen-Laptop/Handy: regelmäßig steuerfrei (private Mitbenutzung erlaubt; § 3 Nr. 45 EStG).
- Erstattung eigener Aufwendungen: mindert Werbungskosten; ggf. Pauschalversteuerung möglich (z. B. Internetzuschuss).
- Raten-/Leasingmodelle: bei Arbeitnehmer:innen meist unerheblich → entscheidend ist beruflicher Nutzungsanteil.
Wenn der Arbeitgeber die Ausstattung stellt, entfällt beim Arbeitnehmer der eigene Werbungskostenabzug.
| Fall | Wert | Abzug | Bewertung |
|---|---|---|---|
| Laptop 1.200 € brutto, 80 % beruflich, Kauf im März | 1.200 € | 80 % → 960 €; bei ND 1 Jahr: voller Abzug im Anschaffungsjahr (zeitanteilig möglich) | OK |
| Monitor 300 € brutto, 100 % beruflich | 300 € | GWG → Sofortabzug 300 € | OK |
| Drucker 600 € brutto, 60 % beruflich | 600 € | Anteilig 360 €; je nach ND Sofort (GWG) oder AfA | anteilig |
| Privates iPad, 20 % beruflich genutzt | 800 € | Nur 20 % ansetzbar (160 €) | geringer Anteil |
| Firmenlaptop gestellt (auch privat erlaubt) | — | Kein Werbungskostenabzug; Nutzung steuerfrei | Steuerfrei |
Belege sammeln, Nutzungsquote kurz begründen, ggf. ND dokumentieren (Rechnungsdatum, Inbetriebnahme).
- 🔹 Rechnung & Zahlung nachweisbar (Datum, Betrag, Gerät).
- 🔹 Beruflichen Nutzungsanteil schätzen & kurz dokumentieren.
- 🔹 GWG-Prüfung (≤ 952 € brutto) – sonst AfA/Nutzungsdauer.
- 🔹 Arbeitgebererstattung? → Dann kein/verminderter Abzug.
- 🔹 Bei PC/Software: kurze ND (≈ 1 Jahr) möglich → voller Ansatz.
| Aussage | Ergebnis |
|---|---|
| GWG bis 800 € netto / 952 € brutto | Sofortabzug |
| Computer/Software | i. d. R. voller Abzug im Jahr |
| Gemischte Nutzung | anteilig nach Quote |
| Arbeitgeber stellt Gerät | Nutzung steuerfrei, kein eigener Abzug |
Praxis: Erst GWG/Sonderregel prüfen, dann Quote festlegen, abschließend Belege ablegen – fertig.
Arbeitszeit & Überstunden
Arbeitszeit & Überstunden
Die Arbeitszeit ist im Arbeitszeitgesetz (ArbZG) geregelt.
Überstunden entstehen, wenn ein Arbeitnehmer mehr arbeitet als im Arbeitsvertrag vereinbart.
Wichtig sind die gesetzlichen Grenzen, die Vergütung und der Ausgleich.
1. Gesetzliche Regelungen
- Regulär max. 8 Stunden pro Tag.
- Ausnahme: bis zu 10 Stunden, wenn innerhalb von 6 Monaten ein Ausgleich erfolgt.
- Ruhezeit: Mindestens 11 Stunden zwischen zwei Arbeitstagen.
- Sonntagsarbeit: Grundsätzlich verboten, nur mit Ausnahmen.
2. Überstunden
- Überstunden sind Mehrarbeit über die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinaus.
- Nur zulässig, wenn angeordnet, gebilligt oder geduldet vom Arbeitgeber.
- Häufig durch Arbeits- oder Tarifvertrag geregelt.
3. Vergütung & Ausgleich
- Überstunden sind grundsätzlich vergütungspflichtig, sofern nichts anderes vereinbart.
- Statt Bezahlung kann Freizeitausgleich erfolgen.
- Regelungen im Arbeitsvertrag sind entscheidend:
Klauseln wie „Überstunden sind mit dem Gehalt abgegolten“ sind nur begrenzt zulässig. - Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen können Sonderregelungen enthalten.
4. Nachweis & Dokumentation
- Arbeitnehmer sollten Überstunden dokumentieren (Zeiterfassung, Stundenzettel).
- Seit EuGH-Urteil 2019: Arbeitgeber müssen ein objektives Zeiterfassungssystem bereitstellen.
- Bei Streitfällen trägt der Arbeitnehmer die Beweislast für geleistete Überstunden.
5. Tipps & Hinweise
- Arbeitsvertrag prüfen: Sind Überstunden geregelt?
- Dokumentation ist entscheidend für die Anerkennung.
- Gesetzliche Höchstgrenzen beachten (Gesundheitsschutz).
- Bei leitenden Angestellten können abweichende Regeln gelten.
Arbeitszeit & Überstunden – schnelle Orientierung
- Max. 8 Std./Tag, ausnahmsweise 10 Std. mit Ausgleich
- Überstunden: nur mit Zustimmung des Arbeitgebers
- Ausgleich: Bezahlung oder Freizeit
Hinweis: Diese Übersicht ersetzt keine individuelle Rechtsberatung.
Verträge und Tarifvereinbarungen können abweichen.
Außergewöhnliche Belastungen
|
ℹ️
Wichtiger Hinweis:
Dieses Wiki dient der allgemeinen Orientierung. Es ersetzt keine individuelle steuerliche Beratung. Für eine persönliche Einschätzung sprich uns jederzeit direkt an. WIKI: Außergewöhnliche Belastungen & PflegepauschbetragVerstehe schnell, welche Kosten du steuerlich geltend machen kannst – von Pflege über Krankheit bis Behinderung.
Steuertipp:
Sammle Rechnungen und Zahlungsnachweise sortiert nach Themen (Krankheit, Pflege, Behinderung).
Wichtig: Kein Nachweis von Einzelkosten nötig – reiner Pauschbetrag.
Voraussetzungen:
Steuertipp:
Wenn du wenig Belege hast, ist der Pauschbetrag fast immer die bessere Wahl.
🧮 Mini-Rechner: Was bringt dir der Pflegepauschbetrag?
Pflegepauschbetrag: 0 €
Geschätzte Steuerersparnis: 0 € Abzugsfähig sind z. B.:
Achtung:
Hier gilt deine persönliche „zumutbare Belastung“. Erst darüber wirkt es steuermindernd.
Pauschbetrag je nach GdB:
Merkzeichen:
Steuertipp:
Pauschbetrag + Fahrtkosten + Pflege können gleichzeitig wirken.
Rechnungen immer überweisen – Barzahlung wird nicht anerkannt.
Maximal 11.604 € jährlich, wenn:
Achtung: Unterhalt in bar ohne Nachweis → fast immer verloren.
Abzugsfähig, wenn der Nachlass nicht ausreicht:
📞
Noch Fragen oder unsicher?
Wir unterstützen dich gerne persönlich – schnell, verständlich und pragmatisch. |
Baulohn
🏗️ Baulohn & Abrechnung im Baulohn
Baulohn ist eine Spezialdisziplin mit eigenen Spielregeln: witterungsbedingte Ausfälle,
Saison-KUG, SOKA-Bau, SEG-Zuschläge & Tarifbindung. Hier findest du das Wichtigste – klar, praxisnah
und im Marcus-Style.
Lohn
Zeiten
Saison
Meldungen
Tarif & Recht
- Witterung & Saison: Ausfälle, Saison-KUG, Mehraufwands- & Zuschuss-Wintergeld
- SOKA-Bau/ULAK: Urlaubsverfahren, Umlagen, Monats-/Jahresmeldungen
- SEG-Zuschläge: Schmutz, Erschwernis, Gefahr; plus Nacht/Sonntag/Feiertag
- Tarifbindung: BRTV/VTV, Mindestlöhne, Branchenzuschläge
- Volatile Zeiten: Baustellen, Wettereinfluss, wechselnde Einsatzorte
Tipp: Baulohn wie „Standardlohn“ zu behandeln, führt fast sicher zu Nachzahlungen.
Grundlage
- Stundenlohn (tariflich/vertraglich, Qualifikation beachten)
- Überstunden (typisch 25 %/50 % – je Tarif)
- Nacht-/Sonntag-/Feiertagszuschläge
- SEG-Zulagen (Schmutz/Erschwernis/Gefahr)
- Auslösung/Wegezeiten je nach Tarif/Projekt
Saison & Ausfall
- Schlechtwetterzeit → Saison-KUG
- Mehraufwands-Wintergeld (MWG)
- Zuschuss-Wintergeld (ZWG)
- Witterungsbedingte Kurzarbeit (Dokumentation wichtig)
Zuschläge sind teils steuer-/sv-frei (Grenzen/Zeiträume beachten). Tariftext & Gesetz prüfen!
Monatsprozess
- Leistungsnachweise/Stundenzettel einsammeln (inkl. Wetter/Ausfall-Codes)
- Erfassung: Grundstunden, ÜSt, Zuschläge, Wege/Auslösung
- Schlechtwettertage kennzeichnen → Saison-KUG Unterlagen vorbereiten
- SOKA-Bau-Meldung (Brutto, Urlaub, Umlagen)
- Lohnabrechnung erstellen, Zahlungen, Reports an Bauleitung
Systeme
Spezialisierte Baulohn-Software (z. B. DATEV Baulohn) mit Schnittstellen zu SOKA-Bau & Agentur für Arbeit bewährt.
- SOKA-Bau/ULAK: Monats-/Jahresmeldungen, Umlagen, Urlaubsstand
- Agentur für Arbeit: Saison-KUG, MWG, ZWG (Fristen + Nachweise!)
- Sozialversicherung: DEÜV-Meldungen, Beitragsnachweise, Krankenkassen
- BG Bau: Unfallversicherung/Umlage
Fristen im Blick behalten – Verspätungen kosten Zuschüsse und erzeugen Rückfragen.
- Witterungsbedingte Verschiebungen, flexible Wochenstunden
- Baustellenwechsel → Wegezeit/Auslösung nach Tarif prüfen
- Zeiterfassung mit klaren Codes (Normal, ÜSt, Nacht, SW-Tag)
Einheitliche Codes + Schulung der Vorarbeiter = weniger Rückfragen im Lohnlauf.
Check je Mitarbeiter: Gewerbezweig (Haupt/Neben), Region, Tätigkeit, Qualifikation.
Tarifliche Mindestlöhne und Branchenzuschläge regelmäßig abgleichen.
Fehlender Tarifabgleich ist eine der häufigsten Ursachen für Nachzahlungen in Prüfungen.
- Falsche/fehlende SOKA-Bau-Meldungen
- Unsaubere Zuordnung von Zuschlägen (steuer-/sv-frei vs. -pflichtig)
- Verspätete/fehlerhafte Saison-KUG-Anträge
- Nichtbeachtung von Mindestlöhnen/Tarifwechseln
- Zeiterfassung ohne Wetterschlüssel/Belege
Onboarding (Mitarbeiter)
- Arbeitsvertrag (Tarifbezug, Lohnart, Qualifikation)
- Steuer/Sozialversicherung, BG-Bau-Zuweisung
- Urlaubsstand/Überträge (SOKA-Bau)
- Baustellen-/Reise-/Auslösung-Regeln
Monatsabschluss
- Stunden & Codes prüfen (ÜSt/Nacht/SW)
- SOKA-Bau-Meldung & AfA-Unterlagen
- Abrechnung, Zahlungsdateien, Auswertungen
- Archiv & Fristenkalender aktualisieren
Fall: Bauarbeiter (Tariflohn 18,00 €/Std.) im Januar (5 Schlechtwettertage).
| Leistung | Berechnung | Betrag (€) |
|---|---|---|
| Grundlohn | 160 Std. × 18,00 | 2.880 |
| Überstunden (25 %) | 20 Std. × 22,50 | 450 |
| Nachtarbeit (15 %) | 10 Std. × 20,70 | 207 |
| Gesamtbrutto | 3.537 |
Ergebnis:
Gesamtbrutto: 3.537 €
– Abzüge (SV, LSt, etc.)
= Netto: ca. 2.200 €
Saison-KUG für 5 Ausfalltage wird über die Agentur für Arbeit abgewickelt
.
Hinweis: Zuschlags- und Steuerbehandlung je nach Tarif/Text variabel – immer den aktuellen Tarif prüfen.
- SOKA-Bau Pflicht? Im Bauhauptgewerbe grundsätzlich ja (ULAK-Verfahren).
- Wer bekommt Saison-KUG? Anspruch bei witterungs-/auftragsbedingten Ausfällen in der Schlechtwetterzeit.
- Zuschläge steuerfrei? Teilweise, mit Grenzen (u. a. Nacht/Sonntag/Feiertag). SEG je nach Ausgestaltung.
- Welche Unterlagen? Stundenzettel mit Codes, Wettervermerke, Baustellenlisten, Tarifnachweise.
Wir übernehmen SOKA-Bau-Meldungen, Saison-KUG-Prozesse, Tarifcheck & laufende Abrechnung – rechtssicher und fristgerecht.
Onboarding-Call vereinbaren & Muster-Stundenzettel erhalten.
Belege per Mail zu Datev Unternehmen online hochladen
Belege per E-Mail in DATEV Unternehmen online hochladen
Belege können per E-Mail direkt in DATEV Unternehmen online hochgeladen werden. Dafür muss die Funktion „Upload Mail“ einmalig eingerichtet werden (dauert ca. 2 Minuten).
Upload Mail einrichten (einmalig)
In DATEV Unternehmen online: Belege → Einstellungen → Upload Mail.
Öffnen Sie „Upload Mail“ und klicken Sie auf „Jetzt einrichten“.

Tragen Sie die E-Mail-Adresse ein, von der aus Sie später Belege senden, und klicken Sie auf „Bestätigungs-E-Mail senden“.

Öffnen Sie Ihr Postfach und klicken Sie auf den Bestätigungslink in der DATEV-Mail. Eventuell ist eine Anmeldung mit DATEV SmartLogin erforderlich.
Nach erfolgreicher Bestätigung erhalten Sie Ihre persönliche DATEV-Zieladresse. Speichern Sie diese am besten als Kontakt (z. B. „DATEV Belege Upload“).
Wenn mehrere Personen Belege senden sollen: zusätzliche Absenderadressen können später eingerichtet werden.
Belege per E-Mail senden
Nach der Einrichtung senden Sie Ihre Belege einfach an die DATEV-Zieladresse.
- Dateiformat: PDF oder TIF
- Max. Größe je Datei: 20 MB
- Maximal 50 Belege je E-Mail
- Empfehlung: 1 Beleg = 1 Datei
In den Einstellungen können Sie z. B. einen Belegtyp vorbelegen oder Benachrichtigungen nur bei Fehlern aktivieren.
Bitte Originalbelege weiterhin aufbewahren (gesetzliche Aufbewahrungspflichten).
Betriebsaufspaltung
Betriebsaufspaltung – kurz erklärt
Trennung von Vermögen (Besitzgesellschaft) und operativem Geschäft (Betrieb) – Chancen und Risiken im Überblick.
Quick-Check: Liegt (oder droht) eine Betriebsaufspaltung?
Betriebsaufspaltung – Absicherung
WIKI: Betriebsaufspaltung – Absicherung & Praxisfälle
Vermeide ungewollte Steuerfallen: Wann Betriebsaufspaltungen enden, welche Folgen drohen – und wie du Strukturen rechtssicher absicherst.
Warum Absicherung wichtig ist
- Eine Betriebsaufspaltung endet, wenn personelle oder sachliche Verflechtung wegfallen.
- Folge: Betriebsaufgabe, Aufdeckung aller stillen Reserven (§ 16 EStG).
- Oft entsteht ein dry income → Steuer, aber keine Liquidität.
- Die Gefahr entsteht häufig durch Erbfälle, Volljährigkeit, Anteilsverkäufe, Grundstücksverkäufe, Mietvertragsänderungen.
💡 Absicherung lohnt sich IMMER, wenn wesentliche Werte im Besitzunternehmen stecken.
Die 6 wichtigsten Absicherungsstrategien
1️⃣ Gewerbliche Prägung oder originär gewerbliche Tätigkeit
- Besitzgesellschaft wird gewerblich geprägt (GmbH als Komplementärin + Geschäftsführung).
- Oder Aufbau einer eigenen gewerblichen Tätigkeit („Substanzanreicherung“).
- Vorteil: Wegfall der Betriebsaufspaltung führt nicht zur Betriebsaufgabe.
2️⃣ Formwechsel der Besitzgesellschaft in eine GmbH
- PropCo-KG → PropCo-GmbH (steuerlich nach UmwStG möglich).
- Kapitalgesellschaft erzielt automatisch gewerbliche Einkünfte.
- 7-jährige Sperrfrist beachten.
3️⃣ Einbringung der PropCo-Anteile in die OpCo
- Besitzanteile → Betriebsgesellschaft (Buchwert nach § 20 UmwStG möglich).
- Personelle Entflechtung wird praktisch ausgeschlossen.
- Achtung bei: Grunderwerbsteuer (bei Grundstücken).
4️⃣ Einheitsbetriebsaufspaltung herstellen
- OpCo-Anteile werden in die PropCo eingebracht.
- Besitzgesellschaft hält 100 % der Betriebsgesellschaft.
- Sperrfristen: 3 Jahre + 7 Jahre.
5️⃣ Erbfolge aktiv gestalten
- Vermeidung von Entflechtung durch geteilte Nachfolge (z. B. Kind A = PropCo, Kind B = OpCo).
- Wiesbadener Modell + Berliner Testament → besonders risikoreich.
- Empfehlung: gleiche Erbfolge oder Holdinglösung.
6️⃣ Betriebsverpachtung im Ganzen nutzen
- Bei Wegfall der Aufspaltung kann das Verpächterwahlrecht wieder aufleben.
- Erlaubt Steueraufschub trotz Entfall der Verflechtungen.
- Bei Volljährigkeit des Kindes → Billigkeitsantrag möglich.
Praxisfälle
Fall 1: Volljährigkeit des Kindes
Minderjährige Kinder + Eltern → Stimmrechte werden addiert.
Mit 18 entfällt die Addition → personelle Verflechtung endet.
Empfehlung: Einheitsbetriebsaufspaltung oder Formwechsel.
Fall 2: Anteilskauf durch Investor
B verkauft 20 % seiner Anteile → Durchsetzungsmacht verliert sich.
Empfehlung: vorher gewerbliche Prägung oder Struktur über Holdings.
Fall 3: Verkauf der einzigen wesentlichen Betriebsgrundlage
Grundstück wird veräußert → sachliche Verflechtung endet.
Empfehlung: erst neue wesentliche Betriebsgrundlage schaffen oder Formwechsel.
Fall 4: Todesfall & Berliner Testament
Beim erstversterbenden Ehepartner unkritisch – beim Überlebenden entsteht plötzlich eine Aufspaltung.
Empfehlung: Testament prüfen & evtl. Holdingstruktur.
Fall 5: Insolvenz der OpCo
Insolvenz → personelle Verflechtung weg → Betriebsaufgabe.
Empfehlung: gewerbliche Prägung oder Einheits-Struktur vorher herstellen.
Checkliste für die Kanzlei
- ✔ Besteht eine Personengruppe mit >50 % Durchsetzungsmacht?
- ✔ Ist eine wesentliche Betriebsgrundlage überlassen?
- ✔ Drohen Erbfälle, Anteilsverkäufe, Volljährigkeit?
- ✔ Existieren Sperrfristen (3 / 7 Jahre)?
- ✔ Sollte die Struktur „sicher gemacht“ werden?
💡 Bei Immobilien in der PropCo immer alle Strukturszenarien durchspielen.
Bewirtungskosten & Geschenke & Betriebsveranstaltungen
🍽️ Bewirtungskosten, Geschenke & Betriebsveranstaltungen
Kanzlei-Wiki • Stand: Oktober 2025
Unternehmer:innen können Bewirtungskosten, Geschenke an Geschäftsfreunde und Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen steuerlich geltend machen – jeweils mit speziellen Voraussetzungen und Grenzen. Das Finanzamt prüft hier besonders genau; saubere Belege sind entscheidend.
§ 37b EStG (30 % Pausch.)
Betriebsveranstaltungen: 110 € pro Kopf
- Geschäftspartner: 70 % der angemessenen Bewirtungskosten sind als Betriebsausgaben abziehbar; 30 % gelten als nicht abziehbar.
- Mitarbeiter:innen (betrieblich): 100 % abziehbar (z. B. Teamessen, interne Besprechung mit Mahlzeit).
- Belegpflicht: Datum, Ort, Anlass und Teilnehmer:innen (mit Funktion) auf dem Bewirtungsbeleg bzw. Zusatzblatt.
| Konstellation | Abzug | Hinweis |
|---|---|---|
| Restaurant mit Kund:innen (200 € brutto) | 70 % | 140 € abziehbar; ordentlicher Bewirtungsbeleg nötig |
| Team-Essen (400 €) | 100 % | betrieblich veranlasst |
Tipp: Bei gemischten Runden Anlass klar dokumentieren und externe Teilnehmende benennen.
- 35 € netto je Empfänger:in und Jahr: bis dahin abziehbar. Wird die Grenze überschritten, ist der gesamte Geschenkaufwand für diese Person nicht abziehbar.
- § 37b EStG: 30 % Pauschalsteuer optional → Geschenk bleibt beim Empfänger steuerfrei; die Pauschalsteuer ist Betriebsausgabe.
- Dokumentation: Geschenkeliste mit Namen, Datum, Anlass, Betrag (netto) und ggf. § 37b-Anwendung.
| Beispiel | Abzug | Praxis |
|---|---|---|
| Werbepräsent 30 € netto | abziehbar | in Geschenkeliste erfassen |
| Präsentkorb 50 € netto | nicht abziehbar | 35-€-Grenze überschritten |
| Mehrere kleine Geschenke, Summe 35 € netto/Jahr | abziehbar | Grenze je Empfänger:in beachten |
USt: Vorsteuerabzug bei Geschenken nur, wenn die 35-€-Netto-Grenze je Empfänger:in eingehalten wird.
- Begünstigt sind max. 2 Veranstaltungen/Jahr (z. B. Sommerfest, Weihnachtsfeier).
- Freibetrag: 110 € inkl. USt je teilnehmende Person. Nur der Mehrbetrag ist steuer-/sv-pflichtiger Arbeitslohn (Freibetrag, keine Freigrenze).
- Einzubeziehende Kosten: alle Aufwendungen mit objektivem Bezug zur Veranstaltung (Raum, Speisen, Getränke, Musik, Event-Agentur, inkl. USt), verteilt auf die Teilnehmenden (einschließlich Begleitpersonen).
- Pauschalierung: Übersteigt der Betrag 110 €, kann der Mehrteil i. d. R. mit 25 % pauschal nach § 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 EStG versteuert werden.
| Beispiel | Wert pro Person | Folge |
|---|---|---|
| Sommerfest, 95 € p. P. | 95 € | steuerfrei (innerhalb Freibetrag) |
| Weihnachtsfeier, 125 € p. P. | 125 € | 15 € steuer-/sv-pflichtig (oder 25 % pauschal) |
| 3. Veranstaltung im Jahr, 80 € p. P. | 80 € | voll steuer-/sv-pflichtig (nicht begünstigt) |
Sachgeschenke anlässlich der Feier bis ca. 60 € (inkl. USt) können in die 110 €-Berechnung einfließen; höherwertige Zuwendungen sind separat zu behandeln.
| Thema | Steuerlicher Abzug | Kernregel |
|---|---|---|
| Bewirtung (Geschäftspartner) | 70 % | Beleg mit Anlass & Teilnehmern |
| Bewirtung (Mitarbeiter:innen) | 100 % | betrieblich veranlasst |
| Geschenke (geschäftlich) | ≤ 35 € netto | je Empfänger:in & Jahr; § 37b optional |
| Betriebsveranstaltung | bis 110 € p. P. | 2 Events/Jahr begünstigt; Mehrbetrag steuerpflichtig |
Dokumentation ist entscheidend: Anlass, Teilnehmende, Beträge, ggf. Pauschalierung nach § 37b/§ 40 EStG vermerken.
Bis wann muss die USt-Voranmeldung abgegeben werden?
Abgabefrist für die Umsatzsteuervoranmeldung
- Regulär: bis zum 10. Tag des Folgemonats
- Mit Dauerfristverlängerung: ein Monat später
- Zahlung: muss zeitgleich mit der Abgabe erfolgen
Tipp: Dauerfristverlängerung frühzeitig beim Finanzamt beantragen, um mehr Zeit für die Meldung zu gewinnen.
USt-Voranmeldung – Abgabefristen & Zahlung
Kurzüberblick für Fristen mit/ohne Dauerfristverlängerung
Regulär
Bis zum 10. Tag des Folgemonats
Mit Dauerfristverlängerung
Ein Monat später (z. B. statt 10. März → 10. April)
Zahlung
Zeitgleich mit der Abgabe überweisen oder per SEPA-Lastschrift einziehen lassen
ein SEPA-Lastschriftmandat hinterlegen – so werden Fristen automatisch eingehalten und
Säumniszuschläge vermieden.
👉 Alle Termine findest du auch in unserem
Steuerkalender.
BMF-Schreiben 24.10.2025 – § 4 Nr. 21 UStG
WIKI: § 4 Nr. 21 UStG – Bildungsleistungen
Umsatzsteuerbefreiung für Unterricht, Aus-/Fortbildung und Umschulung – kompakt mit Beispielen, Matrix und Übergangsregeln.
TL;DR
- Befreit: Leistungen, die unmittelbar dem Schul-/Hochschul-/Aus-/Fortbildungs- oder Umschulungszweck dienen.
- Privatlehrer als eigener Tatbestand (natürliche Person, eigenverantwortlich).
- Digital: Live-Unterricht begünstigt; reine On-Demand-Videos i. d. R. nicht befreit.
- Freizeitangebote (Hobby/Sport/Yoga etc.) meist steuerpflichtig.
- Fahrschule: Berufsklassen (C/CE/D …) begünstigt; Klasse B nicht.
- Übergang: Neuregelung ab 01.01.2025; Nichtbeanstandung alter Praxis bis 31.12.2027.
Vergleich – alt vs. neu
| Aspekt | Bis 31.12.2024 | Ab 01.01.2025 |
|---|---|---|
| Grundlage | § 4 Nr. 21 a bb UStG (alt) | JStG 2024 + BMF-Schr. 24.10.2025 |
| Begünstigte Leistungen | Schulen, Hochschulen, VHS … | Alle Einrichtungen mit unmittelbarem Bildungszweck |
| Privatlehrer | teils mit Anerkennung | eigener Befreiungstatbestand (natürliche Person) |
| Digitale Formen | uneinheitlich | Live-Unterricht begünstigt; On-Demand i. d. R. nicht |
| Freizeit | teils unklar | klar steuerpflichtig (Hobby/Sport etc.) |
| Übergang | – | Nichtbeanstandung bis 31.12.2027 |
Checkliste für Anbieter
- Unterricht/Aus-/Fortbildung/Umschulung?
- Unmittelbarer Bildungszweck (kein Freizeitangebot)?
- Einrichtung oder Privatlehrer (natürliche Person)?
- Kursbeschreibung, Lernziel, Lehrplan
- Vertrag/Teilnahmebestätigung
- ggf. Bescheinigung Landesbehörde / Trägerzulassung
- Text: „umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 21 UStG“
- Eigenes Erlöskonto „§ 4 Nr. 21“
- Mischprogramme sauber aufteilen
Praxisbeispiele – Einordnung
| Beispiel | Status | Hinweis |
|---|---|---|
| Private Musikschule (Lehrplan/Prüfungen) | befreit | Bildungszweck klar |
| Abendkurs Gitarre (Hobby) | steuerpflichtig | Freizeit |
| Online-Mathe-Nachhilfe (live) | befreit | Unterrichtscharakter |
| Yoga/Entspannung | steuerpflichtig | Freizeit |
| Fahrschule C/CE/D … | befreit | berufsbildend |
| Fahrschule B | steuerpflichtig | kein Schul-/Hochschulunterricht |
| E-Learning On-Demand | Einzelfall | nur mit Unterrichtsstruktur |
| Privatlehrer (1:1/Gruppe) | befreit | natürliche Person, eigenverantw. |
Befreiungs-Matrix
- Schul-/Hochschulunterricht → befreit
- Aus-/Fortbildung, Umschulung → befreit
- Live-Online-Unterricht → befreit
- On-Demand-Videos → steuerpflichtig (ohne Unterrichtsstruktur)
- Privatlehrer (natürliche Person) → befreit
- Lehrmaterial/Verpflegung → nur als Nebenleistung
Nachweis & Übergangsregel
- Nachweis über Bescheinigung/Trägerzulassung oder gleichwertige Belege (je Fall).
- Vor 2025 erteilte Bescheinigungen bleiben als Nachweis verwertbar (Details im BMF-Schreiben).
- Nichtbeanstandung abweichender Alt-Praxis bis 31.12.2027.
Empfehlung: Prozesse und Rechnungstexte jetzt auf die neue Linie umstellen; Übergangszeit für Doku nutzen.
FAQ
Ist ein reiner Videokurs steuerfrei?
In der Regel nein – es fehlt der Unterrichtscharakter (Interaktion/Betreuung).
Wer gilt als Privatlehrer?
Nur natürliche Personen, die Unterricht persönlich und eigenverantwortlich erteilen (keine schulähnliche Organisation).
Wie mit Mischprogrammen (z. B. Sprachreise)?
Leistungen aufteilen und dokumentieren (Bildung vs. Reisebestandteile); nur eng verbundene Nebenleistungen begünstigt.
Quelle & Hinweis
Basis: BMF-Schreiben vom 24.10.2025 zur Neufassung § 4 Nr. 21 UStG (JStG 2024). Diese Übersicht dient der Orientierung und ersetzt keine Einzelfallprüfung.
DAC 7 / PLATTFORMEN-STEUERTRANSPARENZGESETZ (PStTG)
WIKI: DAC 7 / PLATTFORMEN-STEUERTRANSPARENZGESETZ (PStTG)
Neue EU-Meldepflichten für Plattformbetreiber und Händler – das musst du wissen.
Kurzfazit
- Seit 2023 gilt in der EU: Plattformen müssen Daten über Händler melden (DAC 7 / PStTG).
- Betroffen: alle Verkäufer, die über Plattformen Umsätze erzielen (z. B. Amazon, eBay, Etsy, Booking).
- Meldungen gehen an die Finanzbehörden → Abgleich mit Steuererklärungen.
💡 Tipp: Händler sollten ihre Stammdaten & USt-Infos korrekt pflegen – sonst droht Sperre auf der Plattform.
Hintergrund & Ziel der Regelung
- EU wollte mehr Steuertransparenz im digitalen Handel.
- Plattformbetreiber werden zu Datenlieferanten der Finanzämter.
- Ziel: Verhinderung von Steuerhinterziehung bei grenzüberschreitendem Onlinehandel.
Wer ist betroffen?
- Plattformbetreiber: müssen Daten sammeln & melden.
- Händler/Verkäufer auf Plattformen: Daten werden automatisch weitergegeben.
- Typische Plattformen: Amazon, eBay, Etsy, Airbnb, Booking, Vinted etc.
- Privatpersonen, die regelmäßig verkaufen → können als steuerpflichtig eingestuft werden.
Welche Daten werden gemeldet?
- Name, Anschrift, Steuer-ID / USt-IdNr.
- Geburtsdatum (bei Privatpersonen)
- Bankverbindung
- Umsätze, Gebühren, Provisionen pro Quartal
- ggf. Immobilienangaben (bei Plattformen wie Airbnb/Booking)
Fristen & Ablauf
- Plattformen müssen jährlich bis 31. Januar des Folgejahres melden.
- Erste Meldung: 31. Januar 2024 (für 2023).
- Daten gehen ans BZSt und werden EU-weit ausgetauscht.
👉 Händler erhalten meist eine Kopie der Meldung von der Plattform – Daten sollten mit der Steuererklärung übereinstimmen.
Typische Risiken für Händler
- Abweichende Angaben zwischen Plattformdaten und Steuererklärung.
- Falsche USt-IdNr. oder fehlende Steuernummer → Plattform sperrt Auszahlung.
- Unklare Privatverkäufe → können steuerpflichtig eingestuft werden.
- Doppelte Meldungen bei mehreren Plattformen.
Checkliste: Was Händler jetzt tun sollten
⚠️ Wer Meldungen ignoriert oder falsche Daten liefert, riskiert Kontosperren & Finanzamt-Rückfragen.
FAQ zu DAC 7 / PStTG
Muss ich selbst etwas melden?
Nein, die Meldung macht die Plattform – aber deine Daten müssen korrekt sein.
Bin ich als Privatverkäufer betroffen?
Wenn du regelmäßig verkaufst, kann die Plattform dich als gewerblich einstufen – Daten werden dann gemeldet.
Wird das mit meiner Steuererklärung abgeglichen?
Ja, die Finanzämter gleichen gemeldete Umsätze mit deinen Angaben ab – Abweichungen führen zu Rückfragen oder Prüfungen.
Darf ich private und geschäftliche Zahlungen über dasselbe Konto laufen lassen?
Bitte trenne privat und geschäftlich. Ein separates Geschäftskonto spart Zeit und vermeidet Zuordnungsfehler. Private Zahlungen vom Geschäftskonto als Privatentnahme kennzeichnen, umgekehrt als Privateinlage.
DATEV Unternehmen online: Belege richtig hochladen
Einleitung
DATEV Unternehmen online ist das zentrale Tool für die digitale Buchführung.
Es ermöglicht dir, Belege schnell und sicher zu erfassen und an deinen Steuerberater zu übermitteln.
Schritt-für-Schritt
- Login mit SmartCard oder SmartLogin
- Bereich „Belege hochladen“ öffnen
- Dateien als PDF/JPG hochladen oder die DATEV Upload App nutzen
Die 5 häufigsten Fehler im E-Commerce
WIKI: DIE 5 HÄUFIGSTEN UMSATZSTEUER-FEHLER IM ECOMMERCE
Typische Stolperfallen + praxisnahe Checkliste – interaktiv ohne JavaScript.
Kurzfazit: Wo passieren die meisten Fehler?
- OSS falsch (oder gar nicht) genutzt bei EU-B2C-Umsätzen.
- Marktplatzfälle (Amazon/eBay) steuerlich falsch eingeordnet.
- IG-Lieferungen ohne gültige USt-IdNr./Nachweise gebucht.
- Digitale Leistungen am falschen Ort besteuert.
- Rechnungsangaben unvollständig (z. B. Reverse-Charge-Hinweis).
Einzelprüfung bleibt Pflicht (Lieferschwelle, Warenlager, B2B/B2C, Leistungsart, Beleglage).
Fehler 1: OSS-Regelung falsch angewendet
- EU-weite 10.000 € B2C-Schwelle ignoriert oder falsch berechnet.
- Umsätze weiterhin je Land gemeldet, obwohl OSS möglich/sinnvoll.
- Warenlager in anderen EU-Ländern übersehen → ggf. lokale Registrierung nötig.
So löst du’s
- Schwelle rollierend überwachen (Kalenderjahr + laufendes Jahr).
- OSS anmelden, wenn überschritten und B2C-Fernverkäufe vorliegen.
- Warenlager/FBA prüfen → evtl. lokale USt-Registrierung zusätzlich.
Mini-Check
- Alle EU-B2C-Umsätze werden in der richtigen Ländersteuer erfasst.
- OSS-Meldung & Zahlungen fristgerecht abgegeben.
Fehler 2: Marktplatzverkäufe falsch besteuert
- Plattform schuldet Steuer (Deemed Supplier) – Händler führt dennoch ab.
- Fehlende Abstimmung von Marktplatz-Abrechnungen und USt-Voranmeldung.
- Falsche Behandlung von Import-One-Stop-Shop (IOSS)-Sendungen.
So löst du’s
- Für jeden Kanal: Zahlschuldner klären (Plattform vs. Händler).
- Abrechnungen (Fees/Tax) monatlich abgleichen.
- IOSS-Nummer korrekt verwenden & dokumentieren.
Merker
- Doppelerfassung vermeiden (Plattform + Händler).
- Country-Codes/Steuersätze der Plattform prüfen.
Fehler 3: Innergemeinschaftliche Lieferung ohne Voraussetzungen
- Keine (oder ungültige) USt-IdNr. des Abnehmers (B2B).
- Unzureichende Beförderungs-/Versandnachweise.
- Fehlende/zweifelhafte Unternehmereigenschaft des Käufers.
| Voraussetzung | Was muss vorliegen? |
|---|---|
| USt-IdNr. | Gültig (VIES) + Abfrage dokumentiert (Datum/Ergebnis). |
| Nachweis | Gelangenbestätigung/CMR/Tracking + Rechnung/Bestellung/Paketlabel. |
| Rechnung | Steuerfrei- und RC-Hinweis, beide USt-IdNrn., Lieferort EU. |
Ohne diese Belege wird die Lieferung regelmäßig steuerpflichtig.
Fehler 4: Digitale Leistungen am falschen Ort besteuert
- Bei B2C Ort beim Verbraucher → Nachweise zum Kundenstandort fehlen.
- OSS für digitale Leistungen nicht genutzt/zu spät.
- B2B falsch: Reverse Charge übersehen.
So löst du’s
- Mind. zwei nicht widersprüchliche Nachweise (IP, Billing, Bank).
- B2C-EU über OSS melden; Drittland: lokale Regeln prüfen.
- B2B: USt-IdNr. prüfen → RC-Hinweis auf die Rechnung.
Praxis
- Shop/PSP so konfigurieren, dass Ländersteuersatz sauber gezogen wird.
Fehler 5: Fehlende/falsche Rechnungsangaben
- Pflichtangaben (USt-IdNr., Anschriften, Leistungsdatum) unvollständig.
- Reverse-Charge-/Steuerfrei-Hinweise fehlen.
- Falscher Steuersatz/Steuerland auf B2C-Rechnungen.
Pflicht-Quickcheck
- Fortlaufende Rechnungsnummer.
- Leistung/Datum/Menge, Steuersatz und Steuerbetrag.
- Eigene USt-IdNr.; beim B2B-Empfänger dessen USt-IdNr. (falls RC/IGL).
- Hinweise: „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“ oder „steuerfrei“.
Template-Tipp
- Ein EU-fähiges Rechnungs-Template mit Logik für RC/IGL/OSS nutzen.
Praxis-Checkliste: einmal im Quartal durchgehen
Tipp: In der Doku zu jedem Beleg „Wer/Was/Wann/Woher“ notieren.
Nachweise & Doku: was der Prüfer sehen will
| Bereich | Muss-Unterlagen | Aufbewahrung |
|---|---|---|
| IG-Lieferung | VIES-Check, Gelangenbestätigung/CMR, Tracking | 10 Jahre (digital ok) |
| Digitale B2C | 2 Standortnachweise (IP/Billing/Bank), OSS-Reports | 10 Jahre |
| Marktplatz | Monthly Tax Reports, Fee-Reports, Payouts | 10 Jahre |
| Rechnungen | Template-Stand, Änderungsprotokoll, Testcases | 10 Jahre |
FAQ: kurze Antworten
Gilt die 10.000 €-Schwelle pro Land?
Nein, sie gilt EU-weit aggregiert für B2C-Fernverkäufe von Waren + bestimmte digitale Leistungen.
Brauche ich trotz OSS lokale USt-Nummern?
Ja, z. B. bei Warenlager/FBA im Ausland oder bei lokalen B2B-Umsätzen.
Wie weise ich B2B bei digitalen Leistungen nach?
Durch USt-IdNr.-Prüfung (VIES) + RC-Rechnung ohne USt; Belege archivieren.
Dienstwagen & private Nutzung
Dienstwagen & private Nutzung
Viele Arbeitnehmer erhalten einen Dienstwagen, den sie auch privat nutzen dürfen.
Der private Vorteil ist steuerpflichtig und kann auf zwei Arten ermittelt werden:
nach der 1%-Regelung oder per Fahrtenbuch.
1. 1%-Regelung
- Monatlich 1 % des Bruttolistenpreises des Fahrzeugs.
- Zuschlag für Fahrten Wohnung ↔ Arbeitsstätte: 0,03 % je km Entfernung pro Monat.
- Bei E-Autos und Plug-in-Hybriden gelten ermäßigte Sätze (0,25 % / 0,5 %).
- Einfach und ohne Dokumentationsaufwand, aber oft steuerlich teurer.
2. Fahrtenbuch
- Erfassung aller Fahrten mit Datum, Zweck, Ziel, Kilometerständen.
- Privatanteil = tatsächliche Kosten × Anteil privater Fahrten.
- Steuerlich oft günstiger bei geringer privater Nutzung.
- Hoher Dokumentationsaufwand, muss zeitnah & lückenlos geführt werden.
3. Vergleich & Beispiele
- Teurer Wagen mit wenig privater Nutzung → Fahrtenbuch vorteilhaft.
- Günstiger Wagen mit viel privater Nutzung → oft 1%-Regelung einfacher.
- Beispiel: Bruttolistenpreis 50.000 € → 1%-Regelung = 500 €/Monat + Zuschläge.
- Fahrtenbuch: Gesamtkosten 8.000 € / Jahr, Privatanteil 20 % = 1.600 € steuerpflichtig.
4. Tipps & Hinweise
- Vorab Vergleich rechnen: Dienstwagen-Rechner (1%-Regel vs. Fahrtenbuch).
- Elektronische Fahrtenbücher können helfen, den Aufwand zu reduzieren.
- Aufbewahrungspflicht: Fahrtenbuch muss bei Betriebsprüfung vorgelegt werden können.
Dienstwagen – schnelle Orientierung
- 1%-Regel: Einfach, pauschal, aber oft teurer
- Fahrtenbuch: Genau, aufwändig, oft günstiger
- E-Autos: Vergünstigte Sätze (0,25 % / 0,5 %)
Hinweis: Diese Übersicht ersetzt keine individuelle Steuerberatung.
Eine Vergleichsberechnung lohnt sich fast immer.
DIGITALE PLATTFORM-STEUERRISIKEN
WIKI: DIGITALE PLATTFORM-STEUERRISIKEN
Amazon, eBay, Etsy & Co. – Chancen für Händler, aber auch Steuerfallen mit Risiko.
Kurzfazit
- Plattformen erleichtern den Markteintritt, bringen aber steuerliche Risiken.
- Typische Fallen: doppelte Besteuerung, falsche Steuersätze, fehlerhafte Reports.
- Wer regelmäßig abgleicht & dokumentiert, reduziert Prüfungsrisiken.
💡 Plattformdaten nie blind übernehmen – immer mit eigener Buchhaltung abgleichen.
Typische Risiken im Überblick
- Doppelte Besteuerung: Marktplatz zieht USt ab, Händler weist trotzdem aus.
- Falsche USt-Sätze: Plattform wendet Standard- statt reduzierten Satz an (oder andersrum).
- Provisionen & Gebühren: werden oft ohne Vorsteuerabzug gebucht.
- Datenabweichungen: Plattform-Reports stimmen nicht mit eigener Buchhaltung überein.
- Auslands-Umsätze: OSS/IOSS nicht korrekt hinterlegt → falsche Steuerabführung.
Praxis-Beispiele
Amazon FBA
Lagerung in anderen EU-Ländern löst lokale USt-Pflicht aus – viele Händler übersehen das.
eBay Verkäufe
Marktplatz führt USt für B2C ab, Händler weist zusätzlich USt auf Rechnung aus → doppelte Besteuerung.
Etsy / Kleingewerbe
Kleinunternehmerregelung wird nicht erkannt → Plattform meldet Umsätze ans FA, Händler erklärt steuerfrei.
Praxis-Tipps für Händler
- 📄 Plattformberichte regelmäßig exportieren & archivieren.
- 🔍 Daten mit eigener Buchhaltung abgleichen (monatlich/vierteljährlich).
- 🌍 USt-Registrierungen prüfen, wenn Lager im Ausland genutzt wird.
- 💶 Provisionen korrekt buchen (inkl. Vorsteuer aus EU-Rechnungen).
- 👨💼 Steuerberater frühzeitig einbeziehen bei OSS/IOSS-Fragen.
Checkliste: Regelmäßig prüfen
👉 Wer diese Punkte quartalsweise prüft, spart Ärger bei Betriebsprüfungen.
FAQ: Häufige Fragen
Muss ich Plattformberichte 1:1 übernehmen?
Nein – sie sind eine Basis, aber nicht immer fehlerfrei. Immer mit eigener Buchhaltung abgleichen.
Wer haftet bei falschen Plattformangaben?
Am Ende der Händler selbst – auch wenn die Plattform Fehler macht.
Wie lange sollte ich Plattformdaten aufbewahren?
Mindestens 10 Jahre – wie Buchhaltungsunterlagen allgemein.
Doppelte Haushaltsführung
🏠 Doppelte Haushaltsführung
Kanzlei-Wiki • Stand: Oktober 2025
🧾 Grundlagen
Arbeitnehmer:innen können die Kosten für eine weitere Wohnung am Beschäftigungsort als Werbungskosten absetzen, wenn der eigene Lebensmittelpunkt am Hauptwohnsitz verbleibt. Die doppelte Haushaltsführung (DHF) muss beruflich veranlasst sein (z. B. weite Entfernung, Versetzung, neue Tätigkeit).
Lebensmittelpunkt am Hauptwohnsitz
Zweitwohnung am Beschäftigungsort
Kernfragen: Eigener Hausstand? • Lebensmittelpunkt? • Berufliche Veranlassung?
✅ Voraussetzungen (mit Eigen-Check als Tabelle)
- Eigener Hausstand am Hauptwohnsitz (finanzielle Beteiligung an Miete/NK + tatsächliche Lebensmitte).
- Zweitwohnung am Beschäftigungsort (Miete, WG, Eigentum).
- Berufliche Veranlassung (z. B. lange Entfernung, Jobwechsel, Projekt).
Wenn dein CMS keine Skripte zulässt, ist der Eigen-Check hier statisch. Für die interaktive Variante bitte als separate HTML-Datei einbinden.
| Frage | Antwort | Bewertung |
|---|---|---|
| Finanziere ich meinen Hauptwohnsitz mit? | Ja/Nein | Wichtig |
| Verbringe ich regelmäßig Zeit dort? | Ja/Nein | Lebensmittelpunkt |
| Ist die Entfernung groß genug? | Ja/Nein | Beruflicher Anlass |
| Habe ich eine Zweitwohnung am Arbeitsort? | Ja/Nein | Zweitwohnung |
💶 Abziehbare Kosten & Höchstbeträge
| Kostenart | Abzug | Grenze / Zeitraum | Praxis |
|---|---|---|---|
| Unterkunft (Miete, NK) | abziehbar | max. 1.000 €/Monat | inkl. Warmmiete & Stellplatz |
| Erstausstattung | abziehbar | keine Grenze | Einrichtung zu Beginn; später Ersatz → Einzelfall |
| Heimfahrten | abziehbar | 1×/Woche Entfernungspauschale | ÖPNV/PKW egal |
| Verpflegung | abziehbar | nur 3 Monate (28 €/14 €) | ab Bezug der Zweitwohnung |
| Umzugskosten | abziehbar | bei berufl. Anlass | nach Umzugskostenrecht |
Unterkunftskosten sind monatlich gedeckelt, Verpflegung nur im ersten Quartal relevant.
🧪 Praxisbeispiele
| Fall | Bewertung | Hinweis |
|---|---|---|
| Ingenieur (300 km), Wohnung am Arbeitsort | DHF möglich | Lebensmittelpunkt bei Familie |
| Lehrerin im Ref., Hauptwohnsitz bei Partner | DHF möglich | Belege: Mietvertrag, Heimfahrten |
| Student mit Nebenjob | keine DHF | kein eigener Hausstand |
🧭 Tipps & Nachweise
- Lebensmittelpunkt belegen (Familienstand, Vereine, Kostenbeteiligung Hauptort).
- Belege für Miete, NK, Heimfahrten, Ausstattung sammeln.
- Verpflegungspauschale nur 3 Monate – Kalender führen.
- Unterkunftskosten monatlich prüfen (max. 1.000 €).
🏁 Fazit
| Aussage | Ergebnis |
|---|---|
| Hauptwohnsitz = Lebensmittelpunkt; Zweitwohnung am Arbeitsort | DHF möglich |
| Unterkunftskosten | max. 1.000 €/Monat |
| Verpflegung | 3 Monate (28 €/14 €) |
| Heimfahrten | 1×/Woche Entfernungspauschale |
Praxis: Nachweise sammeln, Bedingungen erfüllen, monatlich prüfen → sichere Anerkennung beim Finanzamt.
Eigennutzung / Teilvermietung / Airbnb
🏠 Eigennutzung / Teilvermietung / Airbnb – Steuer & USt
Kanzlei-Wiki • Stand: Oktober 2025
Vermietungseinkünfte werden i. d. R. als Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 21 EStG) erfasst. Bei kurzfristiger Vermietung (Airbnb & Co.) droht jedoch der Wechsel in Gewerbebetrieb (§ 15 EStG), insbesondere bei hotelähnlichen Zusatzleistungen.
§ 15 EStG – Gewerbe
§ 9 EStG – Werbungskosten
UStG: § 4 Nr. 12, § 19
Kernfragen: Wie lange wird vermietet? Welche Leistungen werden erbracht? Wie wird aufgeteilt (Fläche/zeitlich)?
| Konstellation | Ertragsteuer | Umsatzsteuer | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Langfristige Vermietung (Wohnzwecke) | § 21 EStG | steuerfrei (§ 4 Nr. 12a UStG) | Regelfall – keine USt, Kleinunternehmer irrelevant |
| Kurzfristige Vermietung (tage-/wochenweise) ohne Service | § 21 EStG | regelmäßig 7 % USt | Hotelähnliche Beherbergung → USt-pflichtig; ggf. § 19 KUR prüfen |
| Airbnb mit Hotelservice (Frühstück, tägliche Reinigung, Rezeption) | § 15 EStG (Gewerbe) | 7 %/19 % USt | Zusatzleistungen kippen in Gewerbe (Gewerbesteuer-Risiko) |
| Eigennutzung + gelegentliche Vermietung (Ferienwohnung) | Einzelfall | ggf. USt-pflichtig | Aufteilung nach Zeit/Fläche; Liebhaberei prüfen |
Gewerbliche Prägung v. a. bei organisatorischem Aufwand und Serviceangebot ähnlich Hotel/Pension.
Bei Teilvermietung sind gemeinsame Aufwendungen (Zinsen, NK, AfA) anteilig aufzuteilen:
| Schritt | Vorgehen | Beispiel |
|---|---|---|
| 1. Flächenquote | vermietete m² / Gesamt-m² | 30 m² / 120 m² = 25 % |
| 2. Zeitquote | Vermietungstage / 365 | 120 / 365 ≈ 32,9 % |
| 3. Gesamtquote | Fläche × Zeit | 25 % × 32,9 % = 8,23 % |
➡️ Die so ermittelte Quote gilt für gemischt genutzte Aufwendungen. Direkte Kosten der vermieteten Einheit sind voll abzugsfähig.
Arbeitszimmer: gesonderte Regeln; bei ausschließlicher Eigennutzung keine V+V-Kosten ansetzbar.
| Fall | USt-Behandlung | Praxis |
|---|---|---|
| Dauervermietung zu Wohnzwecken | steuerfrei | Vorsteuerabzug ausgeschlossen |
| Kurzfristige Vermietung (Beherbergung) | 7 % USt | Option Kleinunternehmer (§ 19 UStG) möglich |
| Zusatzleistungen (Frühstück, Wellness, Events) | teilweise 19 % USt | Leistungsbündel auftrennen/prüfen |
Bei gemischten Tätigkeiten Vorsteuer anteilig; saubere Rechnungen/Aufteilung erforderlich.
| Fall | Ertragsteuer | Werbungskosten | USt | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Eigentumswohnung, 20 m² Zimmer an Student:in (dauerhaft) | § 21 EStG | Flächenquote 20/80 = 25 % auf Gemeinkosten | steuerfrei | unproblematisch |
| Ferienwohnung Eigennutzung 8 Wochen, Vermietung 16 Wochen | § 21 EStG | Zeitquote 16/52 ≈ 30,8 % der Gemeinkosten | 7 % (oder KUR) | Einzelfall/Liebhaberei beachten |
| Airbnb mit Frühstück & täglicher Reinigung | § 15 EStG | Betriebsausgaben, ggf. GWSt | 7 % / 19 % | gewerblich |
| Zwischenvermietung 3 Monate möbliert (berufsbedingt) | § 21 EStG | anteilig | 7 % (KUR prüfen) | sauber dokumentieren |
Bei dauerhafter Verlustsituation Liebhaberei prüfen (Totalüberschussprognose).
| Konstellation | § 23 EStG | Hinweis |
|---|---|---|
| Verkauf innerhalb 10 Jahre | steuerpflichtig | Private Veräußerungsgeschäfte |
| Eigennutzung im Verkaufs- und Vorjahr + dazwischen | steuerfrei | Eigennutzungsprivileg |
| Teilvermietung | Aufteilung | anteilige Steuerpflicht möglich |
Bei gemischter Nutzung: Aufteilung der stillen Reserven nach Flächen-/Zeitanteilen erwägen.
- 🔹 Nutzungskonzept dokumentieren (Dauer-/Kurzfristvermietung, Eigennutzungstage).
- 🔹 Aufteilungsmaßstab festlegen (Fläche/Zeit) und konsistent anwenden.
- 🔹 Airbnb & Co.: Leistungsumfang prüfen (Reinigung, Frühstück, Service-Level).
- 🔹 USt: Wohnraum steuerfrei vs. Beherbergung 7 %; Kleinunternehmerregel prüfen.
- 🔹 Prognoserechnung/Totalüberschuss bei Zweifelsfällen (Liebhaberei).
- 🔹 Kommunale Satzungen (Zweckentfremdungs-/Übernachtungssteuer) im Blick behalten.
| Prüfpunkt | Bewertung | Hinweis |
|---|---|---|
| Nur Wohnzweckvermietung | § 21 / USt-frei | Standard |
| Kurzfrist & Zusatzleistungen | Gewerbe-Risiko | Service kippt in § 15 |
| Saubere Aufteilung | GoBD & prüfungssicher | Fläche×Zeit |
| Aussage | Ergebnis |
|---|---|
| Dauervermietung | § 21 EStG / USt-frei |
| Airbnb ohne Service | § 21 EStG / 7 % USt |
| Airbnb mit Service | § 15 EStG / USt-pflichtig |
| Teilvermietung | Aufteilung nach Fläche × Zeit |
| Verkauf | § 23 beachten (10 Jahre / Eigennutzungsprivileg) |
Klare Dokumentation + konsequente Aufteilung sind der Schlüssel zur Prüfsicherheit.
Elterngeld & Steuerprogression
Elterngeld & Steuerprogression
Das Elterngeld unterstützt Eltern nach der Geburt eines Kindes, wenn sie ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen oder reduzieren.
Es ist zwar steuerfrei, unterliegt aber dem Progressionsvorbehalt – dadurch kann sich die Steuerlast erhöhen.
1. Höhe des Elterngeldes
- Basiselterngeld: 65 % bis 67 % des wegfallenden Nettoeinkommens.
- Mindestens 300 €, höchstens 1.800 € pro Monat.
- ElterngeldPlus: halbierte Monatsbeträge, dafür längere Bezugsdauer.
- Partnerschaftsbonus: zusätzliche Monate bei paralleler Teilzeitarbeit beider Eltern.
2. Progressionsvorbehalt
- Elterngeld selbst ist steuerfrei.
- Es erhöht jedoch den Steuersatz auf das übrige Einkommen (Progressionsvorbehalt).
- Folge: Einkommensteuer kann durch Elterngeld-Bezug spürbar steigen.
- Beispiel: Ohne Elterngeld 30 % Durchschnittssteuersatz → mit Elterngeld 33 % auf das gesamte zu versteuernde Einkommen.
3. Steuerklassenwahl vor der Geburt
- Relevant ist das Nettogehalt in den 12 Monaten vor der Geburt.
- Ein Wechsel in eine günstigere Steuerklasse (z. B. III statt V) kann das Elterngeld erhöhen.
- Wechsel muss spätestens 7 Monate vor Beginn des Elterngeld-Bezugs erfolgen.
- Tipp: Steuerklassen frühzeitig prüfen, am besten direkt nach Schwangerschaftsbeginn.
4. Beispielrechnung
Mutter verdient 2.500 € netto, Vater 3.500 € netto.
- Mutter bezieht 12 Monate Elterngeld → ca. 1.625 € pro Monat.
- Vater bezieht 2 Monate Elterngeld → ca. 2.275 € pro Monat.
- Beide beantragen zusätzlich ElterngeldPlus → längere Bezugsdauer möglich.
- Das Finanzamt setzt die Elterngeldbeträge in den Progressionsvorbehalt → Steuerlast erhöht sich im Steuerbescheid.
5. Tipps & Hinweise
- Steuerklassenwahl rechtzeitig prüfen → kann mehrere tausend € Unterschied machen.
- Mit Progressionsvorbehalt rechnen → Rücklagen für die Steuer einplanen.
- Kombination Basiselterngeld + ElterngeldPlus geschickt planen (z. B. bei Teilzeit).
- Elterngeldrechner der Bundesregierung nutzen:
familienportal.de
Elterngeld & Steuer – schnelle Orientierung
- Basiselterngeld: 300 € – 1.800 € / Monat (65–67 % vom Netto)
- Steuerfrei, aber: Progressionsvorbehalt erhöht den Steuersatz
- Steuerklasse optimieren: spätestens 7 Monate vor Bezug
Hinweis: Diese Übersicht ersetzt keine individuelle Beratung.
Steuerklassenwahl und Progressionsvorbehalt sollten vorab berechnet werden.
Erbschaftsteuer in Deutschland
Erbschaftsteuer – wer zahlt wie viel?
Die Höhe der Erbschaftsteuer hängt stark vom Verwandtschaftsverhältnis ab:
Je näher verwandt, desto höher der Freibetrag und desto niedriger der Steuersatz.
Unsere Tabelle und Beispiele zeigen den Wow-Effekt – und der Rechner macht’s konkret.
1) Steuerklassen & Freibeträge (Auszug)
| Beziehung | Klasse | Freibetrag |
|---|---|---|
| Ehegatte / eingetr. Partner | I | 500.000 € |
| Kinder / Stief-/Adoptivkinder | I | 400.000 € |
| Enkel | I | 200.000 € |
| Urenkel / weitere Abkömmlinge | I | 100.000 € |
| Eltern/Großeltern (Erbfall) | I | 100.000 € |
| Geschwister, Nichten/Neffen, Schwieger- etc. | II | 20.000 € |
| Andere (z. B. Freunde) | III | 20.000 € |
Hinweis: Freibeträge erneuern sich i. d. R. alle 10 Jahre (Schenkungen werden zusammengerechnet).
2) Steuersätze (Tarif § 19 ErbStG – stark vereinfacht)
- Klasse I: 7 % → 11 % → 15 % → 19 % → 23 % → 27 % → 30 % (mit steigenden Betragsstufen)
- Klasse II: 15 % → 20 % → 25 % → 30 % → 35 % → 40 % → 43 %
- Klasse III: 30 % → … → 50 % (oberste Stufen)
Der Steuerbetrag steigt progressiv mit dem steuerpflichtigen Erwerb (nach Abzug von Freibeträgen und Begünstigungen).
3) Zwei schnelle Beispiele (Wow-Effekt)
- Kind erbt 500.000 € → Freibetrag 400.000 € → steuerpflichtig 100.000 € → Klasse I (z. B. ~11 % in dieser Stufe) → ~11.000 € Steuer.
- Freund erbt 500.000 € → Freibetrag 20.000 € → steuerpflichtig 480.000 € → Klasse III (hoher Satz) → deutlich höhere Steuer.
4) Sonderfälle (sehr vereinfacht)
- Familienheim: Unter Bedingungen steuerfrei (z. B. Ehepartner/Kind nutzt es selbst). Im Rechner als freigestellter Betrag.
- Betriebsvermögen: Begünstigungen möglich (z. B. 85 %-Regel bei Fortführung). Im Rechner als vereinfachte 85 %-Freistellung.
- Vorerwerbe (10 Jahre): frühere Schenkungen werden angerechnet und mindern den verbleibenden Freibetrag.
- Mit Schenkungen im 10-Jahres-Takt lassen sich Freibeträge mehrfach nutzen.
- Bei Immobilien und Unternehmen unbedingt Voraussetzungen prüfen (Nutzung, Behaltens-/Lohnsummenregel etc.).
Jetzt selbst rechnen
Unser Tool setzt Freibetrag & Steuerklasse automatisch und zeigt die Steuerlast – inkl. Familienheim & Betriebsvermögen (vereinfacht).
Erhaltungsaufwand – Vermietung
🏗️ Modernisierungskosten vs. Erhaltungsaufwand (§ 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG)
Kanzlei-Wiki • Stand: Oktober 2025
Nach § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG gehören zu den anschaffungsnahen Herstellungskosten alle Aufwendungen für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die innerhalb von drei Jahren nach der Anschaffung des Gebäudes anfallen und insgesamt 15 % der Anschaffungskosten (ohne Grund & Boden) übersteigen.
BMF 18.07.2003
3-Jahres-Frist
Maßnahmen außerhalb dieses Zeitraums oder unterhalb der 15 %-Grenze gelten grundsätzlich als Erhaltungsaufwand → Sofortabzug.
| Schritt | Inhalt | Beispiel |
|---|---|---|
| 1. | Anschaffungskosten Gebäude (ohne Grund & Boden) | 300.000 € |
| 2. | 15 %-Grenze berechnen | 45.000 € |
| 3. | Relevante Kosten (innerhalb 3 Jahre, netto) | 40.000 € |
| 4. | Ergebnis | Erhaltungsaufwand (Sofort) |
Überschreiten die relevanten Maßnahmen 15 % der Gebäude-AK, gelten alle in diesem Zeitraum durchgeführten Arbeiten als Herstellungskosten (Einheitstheorie → AfA).
- Erweiterungen, Anbauten, Aufstockungen (immer Herstellungskosten)
- Außergewöhnliche Schadensbeseitigung (z. B. Brand, Sturm, Hochwasser)
- Betriebsvorrichtungen
- Jährlich wiederkehrende Instandhaltungen (z. B. Wartung, Kleinreparaturen)
Diese Kosten bleiben außerhalb der 15 %-Grenze, selbst wenn sie in die 3-Jahres-Frist fallen.
| Gericht / Datum | Aktenzeichen | Kernaussage |
|---|---|---|
| BFH 09.05.2017 | IX R 6/16 | Einheitstheorie: Überschreitung → alle Maßnahmen HK |
| BFH 14.06.2016 | IX R 25/14 | Unerhebliche Bagatellen bleiben außen vor |
| BMF 18.07.2003 | IV C 3 – S 2211 – 21/03 | Verwaltungsauffassung zur 15 %-Grenze |
Die Einheitstheorie erfasst sämtliche Modernisierungen im 3-Jahreszeitraum, sobald die Summe > 15 % liegt.
- 🔹 Anschaffungskosten ohne Grund & Boden dokumentieren
- 🔹 Zeitraum (3 Jahre ab Übergang) prüfen
- 🔹 Alle Rechnungen mit Datum und Art der Maßnahme auflisten
- 🔹 Ausnahmen kennzeichnen (z. B. Erweiterung, Schaden)
- 🔹 Ergebnis über den 15 %-Rechner validieren
| Ergebnis | Bewertung |
|---|---|
| Summe ≤ 15 % der Gebäude-AK | Erhaltungsaufwand (Sofortabzug) |
| Summe > 15 % innerhalb 3 Jahre | Herstellungskosten → AfA |
Praxis: 3-Jahres-Summenliste führen + Rechner nutzen = prüfsichere Dokumentation.
Fahrtenbuch
Fahrtenbuch führen – Leitfaden & Checkliste
Mit einem ordnungsgemäß geführten Fahrtenbuch kannst du statt der pauschalen 1%-Regel die Fahrtenbuchmethode anwenden und den privaten Nutzungsanteil exakt nachweisen.
Pflichtangaben pro Fahrt
- Datum, Start-/End-Kilometerstand
- Start & Ziel, Umwege begründen
- Reisezweck (z. B. Kundentermin, Lieferung)
- Aufgesuchte Person/Firma
- Private Fahrten als „privat“
- Wohnung – erste Tätigkeitsstätte separat
GoBD-Anforderungen
- Zeitnah & lückenlos (täglich)
- Unveränderbar (keine Excel-Listen)
- Korrekturen nur nachvollziehbar
- Aufbewahrung: 10 Jahre
Typische Fehler
- Lücken/Tage ohne Eintrag → Schätzung droht
- Nur Wochen-/Monatssummen
- Unklarer Zweck („Termin“) statt konkret
- Nachträge ohne Protokollierung
Digitales Fahrtenbuch
Digitale Lösungen sind GoBD-konform, da sie zeitnah & unveränderbar dokumentieren.
- Automatische Aufzeichnung & Kategorisierung
- Export (PDF/CSV) für Steuererklärung & BP
- Mobile App, mehrere Fahrer/Fahrzeuge
👉 Empfehlung: Vimcar
Checkliste – Fahrtenbuch
- Alle Pflichtangaben je Fahrt
- Private Fahrten markiert
- Pendelfahrten separat erfasst
- Einträge zeitnah geführt
- Unveränderbar dokumentiert
- Plausibilisierung mit Belegen
- Export/Archiv je Monat/Jahr
Merksatz: zeitnah, lückenlos, unveränderbar.
1%-Regel vs. Fahrtenbuch – schnelle Orientierung
- 1%-Regel: Einfach, pauschal – lohnt bei teuren Autos & viel privater Nutzung.
- Fahrtenbuch: Genau, aufwändig – vorteilhaft bei geringer privater Nutzung.
- E-Autos: Sonderregeln (0,25 % / 0,5 %) können die 1%-Regel günstiger machen.
- Finanzamt: Anerkennung des Fahrtenbuchs nur bei lückenloser & zeitnaher Führung.
Hinweis: Ob 1%-Regel oder Fahrtenbuch günstiger ist, hängt stark von Fahrzeugwert, Kosten und privater Nutzung ab.
Fahrzeugkosten
Fahrzeugkosten – schnelle Orientierung
- Kfz-Steuer: abhängig von Hubraum, CO₂-Ausstoß, Antrieb
- Versicherung: Haftpflicht (Pflicht), Teil-/Vollkasko nach Bedarf
- Kraftstoff/Strom: laufende Betriebskosten (verbrauchsabhängig)
- Wartung & Reparaturen: Inspektionen, Reifen, Verschleißteile
- Leasing / Finanzierung / Abschreibung: monatliche Belastung
Tipp: Für steuerliche Zwecke kann zwischen Fahrtenbuch und 1%-Regel gewählt werden – siehe unseren Vergleichsrechner.
Familienheim: Schenkung vs. Erbschaft
Familienheim: Schenkung vs. Erbschaft
Das Familienheim (selbstgenutzte Wohnimmobilie) genießt eine besondere
steuerliche Behandlung. Allerdings macht das Gesetz einen großen Unterschied zwischen
Schenkungen zu Lebzeiten und dem Erwerb von Todes wegen.
1) Schenkung (zu Lebzeiten)
- Nur bei Ehegatten/Lebenspartnern: Schenkung des Familienheims ist steuerfrei (§ 13 Abs. 1 Nr. 4a ErbStG).
- Keine Wertgrenze und keine Wohnflächenbeschränkung.
- Auch die Übernahme von Darlehensschulden oder Baukosten ist steuerfrei möglich.
- Kinder: Keine Steuerbefreiung bei Schenkung – es gelten nur die normalen Freibeträge (400.000 €).
2) Erbschaft durch Ehegatten
- Erwerb im Erbfall ist steuerfrei, wenn der Erblasser bis zum Tod im Familienheim gewohnt hat.
- Der überlebende Ehegatte muss unverzüglich einziehen und dort mindestens 10 Jahre wohnen.
- Keine Wohnflächenbegrenzung.
- Wird die Selbstnutzung innerhalb von 10 Jahren aufgegeben, entfällt die Befreiung rückwirkend – außer bei zwingenden Gründen (z. B. Pflegebedürftigkeit).
3) Erbschaft durch Kinder
- Steuerfrei bis zu 200 qm Wohnfläche (§ 13 Abs. 1 Nr. 4c ErbStG).
- Das Kind muss die Immobilie unverzüglich selbst beziehen und mindestens 10 Jahre dort wohnen.
- Bei größerer Wohnfläche ist der übersteigende Teil steuerpflichtig.
- Gibt das Kind die Selbstnutzung innerhalb von 10 Jahren auf, entfällt die Steuerbefreiung (Ausnahme: zwingende Gründe).
4) Praxis-Hinweis
- Schenkung an Ehegatten: in der Regel steuerfrei – oft besser zu Lebzeiten übertragen.
- Schenkung an Kinder: nicht steuerfrei → besser erst im Erbfall übertragen.
- Erbschaft Kinder: Befreiung nur bis 200 qm, daher sorgfältig planen.
Firmenfahrzeuge
🚲 Jobrad, 🚗 Dienstwagen & 0,25 %-Regel (DE)
Kanzlei-Wiki • Stand: Oktober 2025
Private Nutzung von Firmenfahrzeugen wird pauschal mit der 1 %-Regel (Verbrenner) versteuert. Für Elektro-Dienstwagen und Plug-in-Hybride gelten vergünstigte Ansätze: 0,25 % bzw. 0,5 % des Bruttolistenpreises (BLP). Für Fahrten Wohnung ↔ erste Tätigkeitsstätte kommt zusätzlich 0,03 % je Entfernungskilometer bzw. alternativ 0,002 % pro tatsächlicher Fahrt hinzu.
1 % / 0,5 % / 0,25 %
+0,03 % oder 0,002 %
Fahrtenbuch als Alternative
USt-Bewertung ist separat zu betrachten (lohnsteuerliche Vergünstigungen gelten dort nicht automatisch).
| Fahrzeug | Privatnutzung | Voraussetzungen (Kurz) |
|---|---|---|
| Verbrenner | 1 % v. BLP/Monat | Standardregel |
| PHEV | 0,5 % v. BLP/Monat | ≤ 50 g CO₂/km oder elektrische Reichweite ≥ 80 km (für Anschaffungen ab 01.01.2025), sonst 1 %. |
| BEV (reines E-Auto) | 0,25 % v. BLP/Monat | Bis zur jeweils gültigen BLP-Grenze (s. nächste Karte); darüber 0,5 %. |
Die 0,25 %/0,5 %-Vergünstigung gilt auch für den Arbeitsweg-Zuschlag (0,03 %/0,002 %) mit geviertelter/halbierter Bemessungsgrundlage.
Die BLP-Obergrenze für die 0,25 %-Regel wurde angehoben:
| Zeitraum der Anschaffung/Erstzulassung | BLP-Grenze für 0,25 % | Hinweis |
|---|---|---|
| bis 31.12.2023 | ≤ 60.000 € | klassische Regel |
| 01.01.2024 – 30.06.2025 | ≤ 70.000 € | erhöhte Grenze |
| ab 01.07.2025 | ≤ 100.000 € | oberhalb davon gilt 0,5 % |
BLP inkl. USt und werkseitiger Sonderausstattung.
| Methode | Berechnung | Wann sinnvoll? |
|---|---|---|
| 0,03 % | 0,03 % × BLP × Entfernung(km)/Monat | Regelfall, ~15 Fahrten/Monat unterstellt. |
| 0,002 % | 0,002 % × BLP × Entfernung(km) × tatsächliche Arbeitstage | Vorteilhaft bei viel Homeoffice/seltenen Fahrten; jahresbezogene 180-Fahrten-Deckel beachten. |
Entfernung = einfache Strecke, auf volle km abgerundet. Die 0,03 % gilt auch in „Null-Fahrt-Monaten“, wenn der Wagen für den Arbeitsweg überlassen ist – Alternative: 0,002 % mit Nachweis.
| Modell | Steuer | Merkpunkte |
|---|---|---|
| Zusätzlich zum Lohn überlassenes Fahrrad/Pedelec (≤ 25 km/h) | steuerfrei | § 3 Nr. 37 EStG; gilt für Fahrräder & Pedelecs (keine Kfz-Einstufung). |
| Gehaltsumwandlung (Leasing/Jobrad) | 0,25 % v. geviertelter UVP (abgerundet auf 100 €) | Monatlicher geldwerter Vorteil; auch für E-Bikes/Pedelecs. S-Pedelecs (Kfz) folgen Kfz-Regeln. |
Zusätzlich zur Steuerfreiheit/Ermäßigung sind oft Ladestrom & Zubehör begünstigt – USt ggf. abweichend.
| Fall | Ansatz | Rechnung (skizziert) |
|---|---|---|
| BEV, BLP 88.000 €, Privatnutzung | 0,25 % | 0,25 % × 88.000 € = 220 €/Monat (zzgl. Arbeitsweg-Zuschlag; dieser ebenfalls geviertelt). |
| PHEV ab 2025, Reichweite 90 km | 0,5 % | Voraussetzungen erfüllt → 0,5 % statt 1 %. |
| Arbeitsweg: 18 km, BLP 60.000 €, 8 Bürotage/Monat | 0,002 %-Methode | 0,002 % × 60.000 × 18 × 8 = 172,8 € (gegen 0,03 % × 18 = 324 €). |
| Dienstrad per Umwandlung, UVP 3.450 € | 0,25 % vom Viertel | ¼ von 3.450 € = 862,50 € → auf 800 € abrunden → 1 % = 8,00 €/Monat. |
Beispiele ohne Steuerklasse/SV-Effekte – dienen der Systematik.
- Fahrzeugdaten dokumentieren (BLP inkl. Extras, CO₂/elektr. Reichweite, Erstzulassung).
- Für BEV: Preisgrenze (70 k bis 06/2025; 100 k ab 07/2025) prüfen.
- Arbeitsweg bewerten: 0,03 % vs. 0,002 % (Homeoffice, Fahrtenanzahl, 180-Fahrten-Deckel).
- Fahrtenbuch nur wählen, wenn sauber führbar (ansonsten 1 %-Methode).
- Jobrad: „zusätzlich zum Lohn“ (steuerfrei) vs. Gehaltsumwandlung (0,25 %) klar trennen.
| Aussage | Ergebnis |
|---|---|
| BEV-Privatnutzung | 0,25 % bis BLP-Grenze (ab 07/2025: 100 k €), sonst 0,5 %. |
| PHEV-Privatnutzung | 0,5 % bei ≤ 50 g CO₂/km oder ≥ 80 km E-Reichweite (ab 2025), sonst 1 %. |
| Arbeitsweg | +0,03 % je km (pauschal) oder 0,002 % je tatsächlicher Fahrt. |
| Dienstrad | steuerfrei (zusätzlich zum Lohn) / 0,25 % bei Gehaltsumwandlung. |
Stand & Rechtslage laufend beobachten (BMF/BSG/BFH-Verlautbarungen, Ländererlasse).
Quellen (Auswahl): ADAC (0,25 % bis 100 k €), Haufe (Grenzen & 0,03/0,002 %), A&M/Grant Thornton (0,25 % E-Auto), Lohnsteuer-Kompakt (100 k € ab 07/2025), VWFS/Autohero (PHEV-Voraussetzungen), Haufe/Jobrad (steuerfrei § 3 Nr. 37 EStG; 0,25 % bei Umwandlung). ([ADAC][1])
[1]: https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/elektromobilitaet/elektroauto/elektroauto-firmenwagen-steuern/?utm_source=chatgpt.com „E-Auto als Firmenwagen: Versteuerung und Abrechnung …“
Freistellungsauftrag
WIKI: Abgeltungsteuer, Freistellungsauftrag & Sparer-Pauschbetrag
Verstehe, wie Kapitalerträge besteuert werden – und wie du mit Freistellungsaufträgen Doppelversteuerung oder ungenutzte Freibeträge vermeidest.
Grundprinzip
- Kapitalerträge (Zinsen, Dividenden, Kursgewinne etc.) unterliegen der Abgeltungsteuer von 25 % zzgl. Soli (5,5 %) und ggf. Kirchensteuer (8 %/9 %).
- Die Steuer wird direkt von der Bank einbehalten und anonym ans Finanzamt abgeführt – daher „Abgeltung“.
- Der Sparer-Pauschbetrag liegt seit 2023 bei 1.000 € pro Person bzw. 2.000 € bei Ehegatten.
Freistellungsauftrag
- Mit einem Freistellungsauftrag weist du deine Bank an, Kapitalerträge bis zum Pauschbetrag steuerfrei auszuzahlen.
- Der Auftrag kann bis zum Gesamtbetrag (1.000 €/2.000 €) aufgeteilt werden, z. B.:
- Bank A: 600 €
- Bank B: 400 €
- Wichtig: Die Summe aller Freistellungsaufträge darf den gesetzlichen Höchstbetrag nicht überschreiten.
- Bei Gemeinschaftskonten können gemeinsame Aufträge erteilt werden (max. 2.000 €).
Wenn du zu viel freigestellt hast
- Übersteigen alle erteilten Aufträge zusammen den gesetzlichen Betrag, liegt ein „Über-Freistellungsauftrag“ vor.
- Die Banken merken das i. d. R. nicht – sie wenden den Auftrag jeweils wie beantragt an.
- Das Finanzamt berücksichtigt in der Steuer nur bis 1.000 €/2.000 €.
- Der Rest wird nachversteuert → ggf. Nachzahlung.
💡 Unproblematisch, solange du alle Kapitalerträge in der Steuererklärung angibst – dann wird automatisch korrigiert.
Wenn du keinen oder zu kleinen Auftrag erteilt hast
- Ohne (ausreichenden) Auftrag zieht die Bank Abgeltungsteuer ab.
- Über die Anlage KAP holst du zu viel gezahlte Steuer zurück – bis zum Pauschbetrag.
- Günstigerprüfung möglich, wenn persönlicher Steuersatz < 25 %.
💡 Eine KAP lohnt oft, wenn dein Grenzsteuersatz unter 25 % liegt.
Beispiele
Beispiel 1: Zwei Banken
Bank A: Freistellung 800 €
Bank B: Freistellung 600 €
→ Gesamt 1.400 € > zulässig 1.000 €.
Finanzamt berücksichtigt max. 1.000 € – 400 € werden nachversteuert.
Beispiel 2: Kein Auftrag
Keine Freistellung, Zinsen 1.000 €. Bank behält 25 % + Soli ein.
Über Anlage KAP Erstattung, da Freibetrag ungenutzt war.
Beispiel 3: Ehegatten
Gemeinsames Depot, Freistellung 2.000 € – zulässig.
Keine Abgeltungsteuer, solange Kapitalerträge ≤ 2.000 €.
FAQ
Muss ich alle Banken in der Steuererklärung angeben?
Ja, wenn du mehrere Depots/Konten hast. Nur so kann das Finanzamt die Pauschbeträge korrekt zusammenführen.
Kann ich den Freistellungsauftrag während des Jahres ändern?
Ja, jederzeit mit Wirkung für die Zukunft. Rückwirkend geht es nicht.
Wie prüft das Finanzamt doppelte Freistellungsaufträge?
Über Kapitalertragsteuer-Meldungen (ID-basiert). Banken melden freigestellte und steuerpflichtige Erträge.
Wann lohnt sich die Günstigerprüfung?
Wenn dein persönlicher Steuersatz unter 25 % liegt – z. B. bei geringen Gesamteinkünften.
Rechner: Abgeltungsteuer & Freistellungsauftrag
Mehrere Banken? Verteilung optimieren, Über-/Unterdeckung erkennen, Soli/KiSt & Günstigerprüfung simulieren.
Rechner ohne JavaScript: hier öffnen.
Gastronomie
|
📚
Rechte & Pflichten in der GastronomiePraxisleitfaden für Gastronomen – mit Fokus auf saisonale Stände/Weihnachtsmärkte. Keine Rechtsberatung, aber ein kompakter Überblick zur besseren Organisation. 🔎 Schnellüberblick📜 GewerberechtGewerbeanmeldung + ggf. Sondernutzung/Standgenehmigung. Vertragsbedingungen und Platzordnung beachten. 🥗 Hygiene & HACCPLMHV einhalten, Personal schulen, Nachweise/Temperaturen dokumentieren, Trinkwasser & Spülhygiene sichern. 🍷 Jugendschutz & AusschankAltersgrenzen aushängen, Ausweiskontrollen, Schulung, Hausrecht regeln. 💶 Kasse & SteuernGoBD/TSE, Belegausgabe, PreisangabenVO, Tagesabschlüsse, korrekte Steuersätze. 👷 Personal & ArbeitsschutzMindestlohn, Arbeitszeiten, Unterweisungen, Erste Hilfe, SV/Minijob dokumentiert. 🚒 Sicherheit & BrandschutzFettbrandlöscher, Gas/Elektro-Prüfung, Fluchtwege, Rutschschutz, Wetterschutz.
📎 Pflicht-Aushänge (Beispiele)
🧰 Starter-Kit
⚠️ Häufige Fehler
🎯 Sofortmaßnahmen
📊 Kennzahlenidee
🗄️ Aufbewahrung
|
Geschäftsführervergütung – vga
💼 Geschäftsführervergütung & verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)
Kanzlei-Wiki • Stand: Oktober 2025
Eine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) liegt vor, wenn eine Kapitalgesellschaft ihrem Gesellschafter außerhalb der offenen Gewinnverwendung einen Vorteil zuwendet, den ein fremder Dritter nicht erhalten hätte (Fremdvergleich).
§ 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG
BMF 14.10.2002
Typisch: überhöhtes GF-Gehalt, unübliche Tantiemen, private Nutzung von Kfz/Wohnung, Pensionszusagen ohne Fremdvergleich.
- Angemessenheit der Gesamtvergütung (Fixum + Tantieme + Sachbezüge + Versorgungszusage)
- Vertragliche Grundlage muss klar, im Voraus vereinbart und tatsächlich durchgeführt sein
- Leistungsbezogenheit: Vergütung orientiert sich an Art & Umfang der Tätigkeit
- Üblichkeit im Branchenvergleich
Der Fremdvergleich erfolgt nach der sog. Gesamtbetrachtung – entscheidend ist das Gesamtbild der Verhältnisse.
| Fall | Bewertung | Urteil / Hinweis |
|---|---|---|
| GF-Gehalt über Branchenmittel (z. B. > 250 000 € bei kleiner GmbH) | vGA | BFH 14.07.2004 – I R 111/03 |
| Tantieme > 25 % des Jahresüberschusses | vGA-Gefahr | Angemessenheitsgrenze überschritten |
| Pensionszusage ohne Probezeit / ohne Erdienbarkeit | vGA | BFH 28.04.2021 – I R 44/17 |
| Marktübliches Fixum + Tantieme ≤ 50 % | regelmäßig unbedenklich | Fremdvergleich standhält |
| Kfz-Privatnutzung ohne Vereinbarung | vGA | kein klarer Vertrag → § 8 Abs. 3 S. 2 KStG |
| Gehaltssenkung in Verlustjahren | kein Vorteil | fremdüblich (wirtschaftliche Reaktion) |
Praxis: Immer schriftlich, vor Beginn des Wirtschaftsjahres und mit Beschluss dokumentieren.
| Bestandteil | Fremdvergleichliche Angemessenheit | Hinweis |
|---|---|---|
| Festgehalt | branchenüblich | nach Größe, Branche, Verantwortung |
| Variable Vergütung (Tantieme) | bis 25 % OK | darüber hinaus kritisch |
| Weihnachts-/Urlaubsgeld | üblich | kein Problem, wenn marktgerecht |
| Dienstwagen (1 %-Regel) | zulässig | sofern dokumentiert |
| Pensionszusage | kritisch | 15 Jahre Erdienbarkeit; Probezeit ≥ 2 Jahre |
| Auswirkung | Folge | |
|---|---|---|
| bei der GmbH | Gewinnkorrektur → keine Betriebsausgabe (§ 8 Abs. 3 S. 2 KStG) | |
| beim Gesellschafter | Einkünfte § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG | steuerpflichtige Kapitaleinkünfte |
| Gewerbesteuer | keine Hinzurechnung, aber höhere KSt-Basis |
vGA wirkt doppelt: keine Betriebsausgabe bei GmbH, aber steuerpflichtige Einnahme beim Anteilseigner.
- Vertragliche Vereinbarungen vor Beginn des Wirtschaftsjahres abschließen.
- Gesamtvergütung jährlich prüfen (Branche, Umsatz, Gewinnentwicklung).
- Pensionszusagen dokumentieren (Erdienbarkeit, Probezeit, Finanzierung).
- Vergütungsbeschlüsse schriftlich fassen und archivieren.
- Private Nutzungen (Kfz, Wohnung) sauber als geldwerten Vorteil ansetzen.
| Prüfpunkt | Bewertung | Hinweis |
|---|---|---|
| Klare, im Voraus getroffene Vereinbarung | Pflicht | ohne: vGA-Gefahr |
| Angemessenheit Gesamtvergütung | jährlich prüfen | z. B. Vergleichsstudien, BMF-Richtwerte |
| Pensionszusage ohne Probezeit | nicht anerkannt | BFH I R 44/17 |
| Kriterium | Bewertung |
|---|---|
| Angemessene Gesamtvergütung | kein Problem |
| Überhöht / ohne Vertrag | vGA → Gewinnkorrektur |
| Pensionszusage vor Probezeit | vGA |
| Dokumentation vollständig | prüfsicher |
Fazit: Transparente, fremdübliche Vergütung + klare Vertragsgrundlage = keine vGA-Gefahr.
Gewerblicher Grundstückshandel
|
ℹ️
Wichtiger Hinweis:
Dieses Wiki dient der allgemeinen Orientierung zum Thema gewerblicher Grundstückshandel. Es ersetzt keine individuelle steuerliche Beratung. Für eine persönliche Einschätzung sprich uns jederzeit direkt an. WIKI: Gewerblicher GrundstückshandelVerstehe, ab wann Immobilienverkäufe als gewerblicher Grundstückshandel gelten – und welche steuerlichen Folgen das für dich hat. Beim gewerblichen Grundstückshandel geht es um die Abgrenzung:
Wird deine Tätigkeit als gewerblicher Grundstückshandel eingestuft, kann das bedeuten:
Steuertipp:
Wer eigentlich nur „nebenbei“ Immobilien hält, sollte Verkäufe zeitlich und in der Anzahl gut planen – sonst rutschst du ungewollt ins Gewerbe.
Die sogenannte 3-Objekt-Grenze ist eine wichtige Faustregel der Finanzverwaltung:
Wichtig ist dabei:
Die 3-Objekt-Grenze ist keine gesetzliche harte Grenze, sondern nur ein starkes Indiz.
Du kannst auch mit weniger Objekten gewerblich sein – oder mit mehr Objekten noch privat, je nach Einzelfall.
Die Finanzverwaltung schaut nicht nur auf die Anzahl der Objekte, sondern auch auf die Gesamtumstände:
Dokumentiere deine ursprüngliche Absicht (z. B. langfristige Vermietung), falls sich Pläne später ändern.
Das kann in einer späteren Diskussion mit dem Finanzamt helfen.
Wird deine Tätigkeit als gewerblicher Grundstückshandel eingestuft, hat das u. a. folgende Konsequenzen:
Besonders heikel: Wenn bisherige Bestandsobjekte plötzlich Teil eines gewerblichen Grundstückshandels werden,
können stille Reserven auf einen Schlag steuerpflichtig werden.
Lass größere Strukturentscheidungen (z. B. Aufteilung eines Hauses in Eigentumswohnungen mit anschließendem Verkauf)
vorab steuerlich prüfen – nachträgliche Korrekturen sind meist kaum noch möglich.
Häufig wird mit Immobilien über Gesellschaften gearbeitet:
Ob eine GmbH-Struktur sinnvoll ist, hängt stark von deiner Strategie ab (Halten vs. Entwickeln vs. Handeln).
Eine „falsche“ Struktur kann Steuern eher erhöhen als sparen.
Diese Fragen solltest du dir vor einem Immobilienverkauf stellen:
Wenn du mehrere dieser Punkte mit „Ja“ beantworten musst, lohnt sich ein kurzes Vorgespräch,
bevor der Notarvertrag unterschrieben wird.
📞
Unsicher, ob du schon gewerblich bist?
Wir prüfen deine Situation individuell und zeigen dir, wie du Verkäufe steuerlich optimal strukturieren kannst. |
GoBD-Verfahrensdokumentation: Was du wissen musst
GoBD-Dokumentation
Die GoBD fordern eine nachvollziehbare und vollständige
Dokumentation der Prozesse in deinem Unternehmen:
- Organisation – Zuständigkeiten & Abläufe
- Systeme – eingesetzte Software & IT-Struktur
- Archivierung – Aufbewahrung & Nachvollziehbarkeit
👉 Direkt ausprobieren mit unserem
GoBD-Tool.
Grunderwerbsteuer
Grunderwerbsteuer – beim Immobilienkauf unvermeidlich
Die Grunderwerbsteuer fällt beim Kauf von Grundstücken und Immobilien an.
Höhe und Regeln unterscheiden sich je Bundesland.
1) Höhe der Steuer
- Bemessungsgrundlage = Kaufpreis (inkl. Nebenkosten, falls mitgekauft: z. B. Garage, Inventar teilweise ausgenommen).
- Steuersatz je Bundesland: aktuell 3,5 % bis 6,5 %.
- Zahlungspflicht entsteht mit Kaufvertrag, Fälligkeit nach Mitteilung des Finanzamts.
2) Befreiungen & Ausnahmen
- Erwerb durch Ehegatten oder Kinder kann steuerfrei sein.
- Erbschaften und Schenkungen sind keine Grunderwerbsteuer, sondern Erb-/Schenkungsteuer.
- Kleinere Grundstückserwerbe unter 2.500 € meist steuerfrei.
3) Tipps für Käufer
- Beim Kaufvertrag klar trennen: Inventar (z. B. Küche, Möbel) → reduziert Steuerlast.
- Grunderwerbsteuer ist nicht abzugsfähig als Werbungskosten bei Selbstnutzung, aber bei Vermietung über AfA mit drin.
- Finanzierung beachten: Steuer wird kurz nach Kauf fällig und muss mit eingeplant werden.
Grundsteuer
Grundsteuer – was Eigentümer wissen müssen
Die Grundsteuer wird jährlich auf Grundstücke und Immobilien erhoben.
Sie betrifft jeden Eigentümer – egal ob privat, vermietet oder betrieblich genutzt.
1) Wie berechnet sich die Grundsteuer?
- Wert des Grundstücks / Gebäudes (nach neuem Bewertungsmodell ab 2025).
- Steuermesszahl (festgelegt vom Gesetzgeber, je nach Art der Nutzung).
- Hebesatz der Gemeinde (unterschiedlich hoch, oft 200–900 %).
Formel: Grundsteuerwert × Steuermesszahl × Hebesatz der Kommune.
2) Grundsteuerreform ab 2025
- Neue Bewertung für alle Grundstücke → Erklärung bereits 2022 abzugeben.
- Verschiedene Ländermodelle (Bundesmodell, Bayern, Hamburg, etc.).
- Ab 2025 gilt die neue Berechnung, bis dahin noch „alte Werte“.
3) Tipps für Eigentümer
- Bescheide prüfen: Fehler bei Flächen/Nutzungen sind häufig.
- Hebesätze vergleichen: Städte mit hohen Hebesätzen → teure Grundsteuer.
- Bei vermieteten Objekten ist die Grundsteuer auf Mieter umlegbar.
Haushaltsnahe Dienstleistungen
🏡 Haushaltsnahe Dienstleistungen & Handwerkerleistungen (§ 35a EStG)
Kanzlei-Wiki • Stand: Oktober 2025
Privathaushalte können bestimmte Arbeits-, Fahrt- und Maschinenkosten direkt von der Einkommensteuer abziehen – unabhängig vom Steuersatz. Die Ermäßigung beträgt 20 % der begünstigten Kosten; Material ist nicht begünstigt.
Direkter Steuerabzug
Nur unbar bezahlt
Keine Doppelförderung
Auch Mieter:innen können den Arbeitskosten-Anteil aus der Nebenkostenabrechnung ansetzen.
| Kategorie | Max. begünstigte Kosten | Ermäßigung (20 %) | Beispiele |
|---|---|---|---|
| Haushaltsnahe Dienstleistungen | 20.000 € | bis 4.000 € | Reinigung, Garten, Kinder- & Pflegeleistungen, Winterdienst |
| Handwerkerleistungen | 6.000 € | bis 1.200 € | Renovierung, Wartung, Modernisierung, PV-/Heizungs-Montage |
Maximaler Gesamtbonus: 5.200 € pro Jahr (4.000 € + 1.200 €).
- Leistung erfolgt im Haushalt (inkl. Grundstück, Garage, Balkon).
- Rechnung mit getrennter Ausweisung von Arbeits- vs. Materialkosten.
- Unbare Zahlung (Überweisung/Lastschrift) – keine Barzahlung.
- Keine Doppelförderung (z. B. KfW/BAFA/§ 35c EStG) für dieselbe Maßnahme.
- Mieter:innen: Nebenkostenabrechnung mit Arbeitsanteil als Nachweis.
| Maßnahme | § 35a EStG | Hinweis |
|---|---|---|
| PV-Anlage (Montage/Installation) | möglich | Nur Arbeitskosten; nicht, wenn § 35c/KfW/BAFA genutzt wird. |
| E-Auto-Wallbox | möglich | Arbeits-/Anschlusskosten begünstigt, Gerät nicht. |
| Wärmepumpe / Heizung | möglich | Alternativ § 35c (energetische Maßnahmen). Kein Parallelansatz. |
| Smart-Home-Nachrüstung | teilweise | Begünstigt, wenn der Haushaltsführung dient (z. B. Heizung/Lichtsteuerung). |
§ 35a und § 35c schließen sich für dieselbe Maßnahme aus – Wahlrecht prüfen.
| Beispiel | Gesamt | davon Arbeit | Steuerbonus | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Reinigungskraft (Privat) | 2.400 € | 2.400 € | 480 € | 20 % von 2.400 € |
| Gartenpflege (Saison) | 1.000 € | 1.000 € | 200 € | Arbeitskosten vollständig begünstigt |
| PV-Montage (ohne Förderung) | 12.000 € | 4.000 € | 800 € | Nur Arbeitsanteil begünstigt |
| Wallbox-Montage | 2.000 € | 1.000 € | 200 € | Gerät (Material) unbegünstigt |
| Mieter: Hausreinigung (Nebenkosten, 60 % Arbeit) | 300 € | 180 € | 36 € | Arbeitsanteil per NK-Abrechnung |
Beispiele zeigen die Systematik; tatsächliche Effekte je nach Rechnung/Arbeitsanteil.
- ✅ Rechnung mit Arbeits-/Materialtrennung anfordern.
- ✅ Überweisung/Lastschrift (kein Bargeld, kein Paypal-Friends).
- ✅ Bei Förderung (KfW/BAFA/§35c) prüfen: ggf. keine §35a-Begünstigung.
- ✅ Mieter:innen: Arbeitskostenanteil in der NK-Abrechnung dokumentieren.
| Fehlerquelle | Bewertung | Hinweis |
|---|---|---|
| Barzahlung | Ausschluss | Keine Ermäßigung möglich |
| Material abgesetzt | Kürzung | Nur Lohn/Anfahrt/Maschinen begünstigt |
| Doppelförderung | Unzulässig | §35a und §35c nicht kombinieren |
| Punkt | Ergebnis |
|---|---|
| Haushaltsnahe Dienstleistungen | 20 % von Arbeit, max. 4.000 € |
| Handwerkerleistungen | 20 % von Arbeit, max. 1.200 € |
| Material | nicht begünstigt |
| Doppelförderung | verboten (z. B. §35c/KfW/BAFA) |
| Mieter:innen | Arbeitsanteil aus Nebenkosten nutzbar |
Interaktiver Rechner (inkl. Mieter-Modus & Doppelförderungs-Hinweis), CSV-Export & Druckfunktion.
Häusliches Arbeitszimmer & Homeoffice-Pauschale
Häusliches Arbeitszimmer & Homeoffice-Pauschale
Immer mehr Arbeitnehmer arbeiten von zu Hause. Steuerlich gibt es dabei zwei Möglichkeiten:
das häusliche Arbeitszimmer und die Homeoffice-Pauschale.
Wichtig ist die Abgrenzung, wann welche Variante gilt und welche Kosten anerkannt werden.
1. Häusliches Arbeitszimmer
- Voraussetzung: abgeschlossener, separater Raum, der nahezu ausschließlich beruflich genutzt wird.
- Mittelpunkt der gesamten beruflichen Tätigkeit → volle Abzugsfähigkeit der Kosten.
- Wenn kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht → Abzug bis max. 1.260 € pro Jahr.
- Anerkannte Kosten: anteilige Miete, Nebenkosten, Strom, Heizung, Renovierung, Abschreibung (bei Eigentum).
2. Homeoffice-Pauschale
- 6 € pro Tag, maximal 1.260 € pro Jahr.
- Kein separater Raum erforderlich (z. B. Arbeit am Küchentisch möglich).
- Zählt zu den Werbungskosten und wird auf die 1.230 €-Pauschale angerechnet.
- Nicht zusätzlich zum Arbeitszimmer möglich – es gilt entweder oder.
3. Kombination & Beispiele
- Wer ein abgeschlossenes Arbeitszimmer hat → kann Kosten ansetzen (voll oder begrenzt auf 1.260 €).
- Wer keinen separaten Raum hat → nutzt die Homeoffice-Pauschale.
- Beispiel: Lehrer ohne eigenes Arbeitszimmer → 200 Homeoffice-Tage × 6 € = 1.200 € Werbungskosten.
- Beispiel: Selbstständiger mit Arbeitszimmer als Mittelpunkt → anteilige Miet- und Nebenkosten voll absetzbar.
4. Tipps für die Praxis
- Raum muss klar abgrenzbar sein → Durchgangszimmer oder Arbeitsecke zählen nicht.
- Fotos & Grundriss aufbewahren, um das Finanzamt bei Nachfragen zu überzeugen.
- Aufteilung nach Quadratmetern (Arbeitszimmerfläche / Wohnfläche × Gesamtkosten).
- Homeoffice-Pauschale ist eine Jahresobergrenze, egal wie viele Personen im Haushalt arbeiten.
Arbeitszimmer & Homeoffice – schnelle Orientierung
- Arbeitszimmer: nur bei separatem Raum → bis 1.260 € oder voll
- Homeoffice-Pauschale: 6 €/Tag, max. 1.260 € pro Jahr
- Entweder oder: keine Kombination möglich
Hinweis: Diese Übersicht ersetzt keine individuelle Steuerberatung.
Einzelfälle sollten immer geprüft werden.
Höferolle
📖 Höferolle in der Land- und Forstwirtschaft
🔄
Zurück zum Rechner
Klick hier, um direkt wieder zum Abfindungs-Rechner zu springen.
Ein Überblick über Bedeutung, rechtliche Grundlagen und erbrechtliche Besonderheiten.
Definition
Zweck
Rechtliche Grundlage
Praktische Bedeutung
Erbrechtliche Besonderheiten
Die Eintragung in der Höferolle wirkt sich stark auf das Erbrecht aus:
- Anerbensitte: Der Hof geht grundsätzlich an einen einzigen Hoferben über.
- Pflichtteilsrecht: Andere Erben haben nur Anspruch auf eine Abfindung, die sich am Ertragswert (Hofeswert) orientiert – oft deutlich niedriger als der Verkehrswert.
- Bewertung: Für Zwecke der Erbschaftsteuer wird der Hof nach dem Bewertungsgesetz (BewG) bewertet (§§ 158 ff. BewG).
- Steuerliche Begünstigungen: § 13a/13b ErbStG: 85 % Verschonung (Option: 100 %) + gleitender Abzugsbetrag bis 150.000 €.
- Behaltensfristen: Fortführung 5 Jahre (Optionsverschonung: 7 Jahre).
- Fallstricke: Verkauf/Umnutzung, nicht-LuF-Überlassung, Überentnahmen > 150.000 € ⇒ Liquidationswert + (teilweiser) Wegfall der Begünstigung.
Steuerliche Besonderheiten (EStG)
Bei Hofübergaben und erbrechtlichen Regelungen spielen die Vorschriften des Einkommensteuerrechts eine zentrale Rolle:
- Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (§ 13 EStG): Abgrenzung zu Gewerbebetrieb; umfasst auch Nebenbetriebe, Sondernutzungen und Teilbetriebe. Wichtig: 100-km-Grenze bei Flächenverlagerung.
- Forst als Teilbetrieb: Forstflächen gelten als eigener Teilbetrieb. Sie können im Rahmen von Hofübergaben steuerneutral übertragen oder zurückbehalten werden, ohne stille Reserven aufzudecken.
- Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen (§ 13a EStG): Für kleinere Betriebe möglich; Übergang oder Aufgabe kann Sonderfolgen auslösen.
- § 13 Abs. 5 EStG: Steuerfreie Entnahmen für Wohngebäude (Betriebsleiterwohnung, Altenteilerhaus). Relevanz bei Übergabe mit Wohnrecht.
- Versorgungsleistungen (§ 10 Abs. 1a Nr. 2 EStG): Altenteilsleistungen an Übergeber sind beim Erwerber als Sonderausgaben abziehbar, wenn sie auf echten LuF-Betrieb bezogen sind.
- Private Veräußerungsgeschäfte (§ 23 EStG): Können bei Entnahmen, Schenkungen oder teilentgeltlichen Übertragungen greifen – wichtig bei Pflichtteilsregelungen.
- Tarifermäßigung (§ 32c EStG): Entlastung bei stark schwankenden Gewinnen, insbesondere bei Übergabe oder Betriebsaufgabe.
Checkliste Hofübergabe
-
✅
Höferolle prüfen: Ist der Betrieb eingetragen und anerkannt? Grundlage für Sondererbfolge.
-
✅
Hoferbe festlegen: Testament, Erbvertrag oder Übergabevertrag?
-
⚠️
Pflichtteilsansprüche: Abfindung bemisst sich am Hofeswert, nicht am Verkehrswert. Weichende Erben einbeziehen.
-
✅
Altenteilsleistungen (§ 10 EStG): Versorgung des Übergebers steuerlich abziehbar, wenn echter LuF-Betrieb.
-
✅
Wohnrecht (§ 13 Abs. 5 EStG): Steuerfreie Entnahme für Altenteiler-/Betriebsleiterwohnung möglich.
-
⚠️
Forstflächen: Eigener Teilbetrieb – steuerliche Sonderbehandlung beachten.
-
✅
Steuerliche Begünstigungen (§ 13a/b ErbStG): 85 % bzw. 100 % Verschonung + Abzugsbetrag bis 150.000 €.
-
⚠️
Behaltensfristen: 5/7 Jahre einhalten. Verkauf/Umnutzung kann Nachbewertung (§ 166 BewG) auslösen.
-
✅
Gewinnermittlung (§ 13a EStG): Prüfen, ob Durchschnittssatz oder Regelgewinnermittlung günstiger ist.
-
⚠️
Private Veräußerungsgeschäfte (§ 23 EStG): Bei Entnahmen oder teilentgeltlichen Übertragungen droht Steuerpflicht.
🧭 Schema & Timeline: Hofübertragung (Höferolle)
Schnellüberblick: Hofstatus → Bewertung → Verschonung → Erbrecht → Fristen → Fallstricke
1) Hofstatus (HöfeO)
Eintragung als anerkannter Hof in die Höferolle (Landwirtschaftsgericht). Grundlage für Sondererbfolge (Anerbensitte).
HöfeOHöferolle
2) Bewertung (BewG)
Wirtschaftsteil (§§ 162–166 BewG), Wohnteil/Betriebswohnung (§ 167 BewG) separat.
GrundbesitzwertReingewinn/Mindestwert
3) Erb-/Schenkungsteuer
§§ 13a/13b ErbStG: 85 % Verschonung bzw. 100 % Option + gleitender Abzugsbetrag bis 150.000 €.
§ 13a/13b ErbStGBegünstigt
4) Erbrecht
Hoferbin/Hoferbe festlegen. Abfindungen der übrigen Erben am Hofeswert (Pflichtteil abgeschwächt).
AnerbensittePflichtteil
5) Behaltensfristen
Fortführung 5 Jahre (Option: 7 Jahre), Lohnsummenregel meist irrelevant (≤ 5 MA).
§ 13a Abs. 3/6 ErbStG
6) Fallstricke
Verkauf/Umnutzung, Überlassung zu nicht-LuF-Zwecken, Überentnahmen > 150.000 € ⇒ Liquidationswert (§ 166 BewG) + (teilweiser) Wegfall der Begünstigung.
Nachbewertung§§ 162/166 BewG
Hofstatus prüfen
Höferolle & Anerkennung
Landwirtschaftsgericht
Bewertung
Wirtschaftsteil (BewG), Wohnteil separat
Reingewinn/Mindestwert
Verschonung wählen
85 % / 100 % (Option)
+ Abzugsbetrag bis 150 k
Erbrecht regeln
Hoferbe festlegen, Abfindungen
Hofeswert ≠ Verkehrswert
Fristen einhalten
5/7 Jahre, keine schädliche Nutzung
Reinvest-Fenster 6 Monate
Wirtschaftsteil Steuerwert: 1.100.000 € – Wohnteil 100.000 € (nicht begünstigt).
- Verschonung 85 % ⇒ 935.000 €
- Gleitender Abzugsbetrag bis 150.000 €
- Ergebnis: regelmäßig ~0 € steuerpflichtig (ohne schädliche Verwendung)
Holding
Holdinggesellschaft
Eine Holdinggesellschaft ist eine Muttergesellschaft, die Anteile an anderen
Unternehmen (Tochtergesellschaften) hält. Sie kann rein verwaltend tätig sein oder auch strategische
Aufgaben übernehmen.
1. Vorteile einer Holding
- Steuerliche Vorteile: Gewinnausschüttungen & Veräußerungsgewinne i. d. R. zu 95 % steuerfrei (§ 8b KStG).
- Vermögensschutz: Risiken werden auf operative Tochtergesellschaften verteilt.
- Flexibilität: Beteiligungen an mehreren Unternehmen lassen sich bündeln und steuern.
- Nachfolge & Investoren: Geeignet für Unternehmensnachfolge und Beteiligungsmodelle.
2. Nachteile einer Holding
- Gründungs- & Verwaltungskosten: zusätzliche Jahresabschlüsse, Buchhaltung, Steuerberatung.
- Komplexität: Konzernstrukturen erfordern erhöhte Transparenz- und ggf. Konsolidierungspflichten.
- IHK-Pflicht: Jede Kapitalgesellschaft (auch eine reine Holding) ist Mitglied der IHK & beitragspflichtig. Kleine Holdings profitieren teils von Beitragsfreigrenzen.
- Operative Gewinne: bleiben voll steuerpflichtig in der Tochtergesellschaft, Steuerfreiheit gilt nur für Ausschüttungen/Verkäufe auf Holding-Ebene.
3. Holding & Gewerbesteuer
- Grundsätzlich ist auch eine reine Holding gewerbesteuerpflichtig.
- Die Steuerbelastung ist aber häufig gering, da 95 % der Dividenden und
Veräußerungsgewinne bei der Ermittlung des Gewerbeertrags außer Ansatz bleiben. - Befreiung: Vollständig befreien kann man sich von der Gewerbesteuer in der Regel nicht.
Ausnahme: Eine Holding, die nur eigenes Vermögen verwaltet (sog. Vermögensverwaltende Gesellschaft)
und nicht als Gewerbebetrieb eingestuft wird. Dann ist sie aber keine klassische
Kapitalgesellschaft mehr, sondern eher eine vermögensverwaltende Personengesellschaft oder
Familienstiftung. - 👉 Fazit: Eine „echte“ Holding (GmbH/AG) ist immer gewerbesteuerpflichtig, profitiert aber
von den Freistellungen bei Beteiligungserträgen.
Holding – schnelle Orientierung
- Vorteile: Steuerfreiheit bei Ausschüttungen/Verkäufen, Vermögensschutz
- Nachteile: Verwaltungskosten, IHK-Pflicht, Komplexität
- Gewerbesteuer: grundsätzlich Pflicht, aber Belastung meist gering
Hinweis: Diese Übersicht ersetzt keine Steuerberatung. Ob eine Holding-Struktur sinnvoll ist,
hängt stark von der Unternehmenssituation und geplanten Transaktionen ab.
Internationales Steuerrecht
Internationale Fälle sind oft komplex – mit Doppelbesteuerungsabkommen, Progressionsvorbehalt und besonderen Dokumentationspflichten.
Damit Sie den Überblick behalten, haben wir für Sie Quick-Rechner, wichtige Hinweise und eine Checkliste zusammengestellt.
So können Sie sich schnell orientieren und optimal vorbereitet ins Gespräch gehen.
👉 Wählen Sie unten die passende Kategorie aus, um direkt die Rechner, Hinweise oder unsere Checkliste zu öffnen.
❓ FAQ – Internationale Steuerfälle
Wie berechnet man den Progressionsvorbehalt?
Der Progressionsvorbehalt nach § 32b EStG bewirkt, dass steuerfreie Auslandseinkünfte zwar nicht in Deutschland versteuert werden,
aber den Steuersatz für die übrigen Einkünfte erhöhen. Unser 📈 Progressionsvorbehalt-Rechner berechnet die Steuer exakt nach § 32a EStG.
Wann greift die 183-Tage-Regel?
Die 183-Tage-Regel gilt nach den meisten Doppelbesteuerungsabkommen (DBA), wenn ein Arbeitnehmer in einem anderen Staat arbeitet,
dort aber maximal 183 Tage pro Jahr anwesend ist, der Arbeitgeber nicht im Tätigkeitsstaat sitzt und die Vergütung nicht von einer Betriebsstätte getragen wird.
Nutzen Sie dafür unseren 🌍 Grenzgänger-Check.
Wie funktioniert die Quellensteuer-Anrechnung?
Wenn Einkünfte im Ausland besteuert werden, kann die dort gezahlte Steuer nach § 34c EStG auf die deutsche Steuer angerechnet werden,
soweit sie die deutsche Steuer auf diese Einkünfte nicht übersteigt. Details liefert unser Quellensteuer-Check.
Wie wird ein Betriebsstättengewinn verteilt?
Gewinne müssen nach dem sog. AOA (Authorized OECD Approach) funktions- und risikogerecht zwischen Hauptsitz und Betriebsstätte aufgeteilt werden.
Ein einfacher Einstieg gelingt mit unserem 🏭 Betriebsstättengewinn-Rechner.
Inventur vorbereiten: So gehst du vor
Inventur zum Jahresende
Am Jahresende ist eine Inventur gesetzlich vorgeschrieben.
Sie dient als Grundlage für die Bewertung deines Vermögens und bildet die Basis für einen
prüfbaren Jahresabschluss.
- Bestände zählen – alle Waren, Rohstoffe und Betriebsmittel erfassen
- Inventurlisten führen – sauber dokumentieren, wer wann was gezählt hat
- Wertansätze prüfen – z. B. Einkaufspreise, Niederstwertprinzip, Abschreibungen
Tipp: Eine sauber durchgeführte Inventur sichert dir
einen prüfungssicheren Abschluss und verhindert spätere Diskussionen mit dem Finanzamt.
Investitionsabzugsbetrag (IAB)
Investitionsabzugsbetrag (IAB) – schnelle Orientierung
- Bis zu 50 % der voraussichtlichen Anschaffungskosten können vorab steuermindernd geltend gemacht werden
- Nur für betriebliche Wirtschaftsgüter (mind. 90 % betrieblich genutzt)
- Einzusetzen in den folgenden 3 Jahren für die geplante Investition
- Wird nicht investiert → Nachversteuerung + Zinsen
- Besonders interessant für kleinere Betriebe mit schwankendem Gewinn
Hinweis: Der IAB ist ein Gestaltungsmittel, sollte aber sorgfältig geplant und dokumentiert werden, um Nachversteuerungen zu vermeiden.
Kapitalerträge
WIKI: KAPITALERTRÄGE – AKTIEN, ETFS, KRYPTO & CFDS
Abgeltungsteuer richtig einordnen, Verlusttöpfe nutzen, Quellensteuer beachten – kompakt & praxisnah.
Kurzfazit
- Kapitalerträge (u. a. Dividenden, Zinsen, Kursgewinne, Derivate) unterliegen i. d. R. der Abgeltungsteuer 25 % zzgl. Soli und ggf. Kirchensteuer.
- Sparer-Pauschbetrag: 1.000 € p. P. / 2.000 € bei Zusammenveranlagung – per Freistellungsauftrag nutzen.
- Verlustverrechnungstöpfe getrennt führen (Aktien / Sonstige). Für Termingeschäfte gelten Limits.
- Bei Kryptowährungen unterscheiden: direkter Besitz (Spekulationsfrist) vs. CFD/Zertifikate (Abgeltungsteuer).
💡 Jahressteuerbescheinigung & Broker-CSV aufbewahren – erleichtert Erklärung & Verrechnung.
Abgeltungsteuer & Grundregeln
- 25 % Abgeltungsteuer + 5,5 % Soli auf die Steuer + ggf. 8/9 % Kirchensteuer.
- Sparer-Pauschbetrag vorab abziehen (Freistellungsauftrag bei Bank/Depot hinterlegen).
- Verlusttöpfe:
- Aktien-Topf (nur mit Gewinnen aus Aktien verrechenbar)
- Allgemeiner Topf (Zinsen, Fonds, Zertifikate usw.)
- Termingeschäfte: negatives Ergebnis i. d. R. nur bis 20.000 € p. a. verrechenbar
- Quellensteuer ausländischer Dividenden häufig bis 15 % anrechenbar (DBA beachten).
Aktien & ETFs
Was ist steuerpflichtig?
- Dividenden immer steuerpflichtig
- Kursgewinne unabhängig von Haltedauer (keine Spekulationsfrist seit 2009)
- Teilfreistellung bei Fonds (z. B. 30 % bei Aktienfonds) mindert die Bemessungsgrundlage
Praxis
Bank führt die Steuer i. d. R. automatisch ab (Bescheinigung).
Ausländische Dividenden: Quellensteuer prüfen/erstatten lassen.
CFDs & Derivate
- Gewinne/Verluste sind Kapitalerträge; Abrechnung meist direkt durch den Broker.
- Verlustverrechnung aus Termingeschäften i. d. R. bis 20.000 € p. a. begrenzt; Überhänge vortragsfähig.
- Zertifikate/Optionen/Futures: je nach Ausgestaltung „Sonstige“ bzw. Termingeschäfte – Dokumentation wichtig.
Kryptowährungen
- Direkter Besitz (Wallet/Börse als Wirtschaftsgut): Veräußerungsgewinne nach 12 Monaten regelmäßig steuerfrei (Privatvermögen).
- Verkauf vor Ablauf der 12 Monate → steuerpflichtig mit persönlichem Steuersatz.
- Staking/Lending kann die Haltefrist verlängern (bis 10 Jahre).
- Krypto-CFDs/Zertifikate: wie Kapitalerträge (Abgeltungsteuer), keine Spekulationsfrist.
Nachweise (CSV, Tx-IDs, Screenshots) sammeln – Finanzamt verlangt belastbare Dokumentation.
Beispielrechnungen
| Fall | Bemessung | Steuer grob |
|---|---|---|
| Dividende 1.000 € | nach Pauschbetrag | ≈ 25 % + Soli (+ ggf. KiSt) |
| Aktiengewinn 5.000 € | Abgeltungsteuer | ≈ 1.313 € (ohne KiSt) |
| CFD-Verlust 40.000 € | Verrechenbar p. a. | bis 20.000 €; Rest Vortrag |
| Bitcoin-Verkauf nach 13 Monaten | Spekulationsfrist überschritten | 0 € |
Richtwerte für die Einordnung. Individuelle Situation (Kirchensteuer, Teilfreistellungen, Verlusttöpfe) kann abweichen.
FAQ
Wie nutze ich den Sparer-Pauschbetrag?
Freistellungsauftrag bei Bank/Depot hinterlegen; sonst Einbehalt und ggf. Erstattung über die Steuererklärung.
Kann ich Aktien-Verluste mit Fonds-Gewinnen verrechnen?
Aktien-Verluste nur mit Gewinnen aus Aktien verrechenbar; sonstiger Topf separat.
Was ist mit ausländischer Quellensteuer?
Häufig bis 15 % anrechenbar; DBA-Regeln prüfen, ggf. Erstattungsverfahren.
Gilt bei Krypto die 1-Jahres-Frist immer?
Für Privatvermögen regelmäßig ja; Sonderfälle (z. B. Staking/Lending) beachten.
Tools & Unterstützung
Mit unserem Tool können Sie Erträge kalkulieren und CSV/XLSX importieren.
Kassenbuch führen: Praxisleitfaden in 10 Minuten
📘 Kassenbuch – Grundlagen, Pflichten & häufige Fehler
Das Kassenbuch ist für Betriebe mit Bargeldgeschäften Pflicht und muss jederzeit kassensturzfähig sein. Unser internes Tool 🧾 Kassenbuch führt dich GoBD-konform durch Erfassung, Tagesabschluss, Zählprotokoll und DATEV-Export (EXTF).
💡 Schnellstart: Öffne das interne Kassenbuch, lege den Anfangsbestand fest, erfasse Bewegungen laufend und schließe den Tag mit dem Zählprotokoll ab. Exportiere am Monatsende die EXTF-Datei für DATEV.
Kassenführung in Datev Unternehmen online
📘 Nutzung der Kasse in DATEV Unternehmen onlineGoBD-konforme Erfassung, Korrekturen und Abschlüsse in DATEV Unternehmen online (DUO). 1. EinleitungDie Kassenfunktion in DATEV Unternehmen online (DUO) ermöglicht die digitale Erfassung, Verwaltung und Übermittlung von Kassenbelegen – ideal für Betriebe mit täglichem Barverkehr (Einzelhandel, Gastronomie, Praxen).
2. Voraussetzungen
3. Aufbau der KassenmaskeDu erreichst die Kasse über Unternehmen online → Anwendungen → Kasse. Typische Spalten:
4. Erfassung von BuchungenEinnahme buchen
Ausgabe buchen
5. Kassenabschluss
6. Korrekturen & StornosVor dem KassenabschlussBuchungen können bearbeitet oder gelöscht werden:
Nach dem KassenabschlussDirekte Änderungen sind nicht möglich. Stattdessen eine Korrekturbuchung anlegen:
Nach Export an KanzleiÄnderungen in DUO nicht mehr möglich. Bitte Korrekturwunsch mit Datum, Betrag und Buchungstext an die Kanzlei übermitteln. Zusammenfassung
7. GoBD-konformes Arbeiten
8. Praktische Tipps
9. Häufige Fehlerquellen
|
KI IN DER BUCHHALTUNG – CHANCEN & GRENZEN
WIKI: KI IN DER BUCHHALTUNG – CHANCEN & GRENZEN
Wie Künstliche Intelligenz Prozesse beschleunigt – und warum der Steuerberater trotzdem unverzichtbar bleibt.
Kurzfazit
- KI-Tools automatisieren Routine (Belege, Zahlungsabgleich, Reporting).
- Mehr Effizienz, weniger Tippfehler, schnellere Prozesse.
- Aber: Verantwortung & steuerliche Würdigung bleiben beim Menschen.
💡 KI ist ein Werkzeug – kein Ersatz für steuerliche Beratung.
Anwendungsfelder für KI in der Buchhaltung
📑 Belegerkennung
Rechnungen automatisch auslesen, Kontierungsvorschläge machen, Dubletten erkennen.
💳 Zahlungsabgleich
Bankumsätze automatisch mit Rechnungen matchen – weniger offene Posten.
📊 Reporting
Echtzeit-Kennzahlen, Liquiditätsprognosen, Dashboard-Analysen.
🧾 Umsatzsteuer
Automatische Prüfung von Steuersätzen & USt-IdNrn., Hinweis auf Auffälligkeiten.
Chancen durch KI
- ⏱️ Zeiteinsparung bei Routinebuchungen.
- ✅ Weniger Fehler durch Automatisierung.
- 📈 Schnellerer Überblick über Unternehmenszahlen.
- 💬 Bessere Kommunikation zwischen Mandant & Kanzlei (digitale Workflows).
Grenzen & Risiken
- Keine steuerliche Würdigung: KI versteht keine Rechtsnormen im Einzelfall.
- Haftung: Verantwortung liegt immer bei Unternehmer & Steuerberater.
- Datenschutz: sensible Belegdaten erfordern DSGVO-konforme Tools.
- Fehlerhafte Vorschläge möglich – menschliche Kontrolle bleibt Pflicht.
Checkliste: So setzt du KI sinnvoll ein
👉 KI ist stark bei Routine – Entscheidungen & Steuerstrategien bleiben Sache des Beraters.
FAQ zu KI in der Buchhaltung
Ersetzt KI den Steuerberater?
Nein – KI kann automatisieren, aber keine individuelle steuerliche Würdigung vornehmen.
Welche Tools sind empfehlenswert?
Bekannte Anbieter sind z. B. DATEV KI-Module, Candis, GetMyInvoices, Circula – Auswahl hängt von Bedarf & Budget ab.
Wie prüfe ich die Ergebnisse?
Regelmäßige Stichproben & Freigabeprozesse einbauen – KI ist nur so gut wie ihre Daten.
Kindergeld & Kinderfreibeträge
Kindergeld & Kinderfreibeträge
Eltern erhalten für ihre Kinder entweder Kindergeld oder es werden die
Kinderfreibeträge berücksichtigt. Das Finanzamt prüft automatisch im
sogenannten Günstigervergleich, welche Variante vorteilhafter ist.
1. Kindergeld
- Seit 2023: 250 € pro Kind und Monat.
- Anspruch grundsätzlich bis zum 18. Geburtstag.
- Verlängerung bis max. 25 Jahre möglich bei Ausbildung, Studium oder Freiwilligendienst.
- Beantragung über die Familienkasse.
2. Kinderfreibeträge
- 2025: 6.612 € pro Kind (Steuerfreibetrag für das Existenzminimum des Kindes).
- Dazu kommt der Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsfreibetrag (BEA) von 2.928 €.
- Freibeträge wirken sich über die Steuerlast aus → Vorteil bei höheren Einkommen.
- Werden bei getrennten Eltern jeweils zur Hälfte berücksichtigt (abweichende Aufteilung möglich).
3. Günstigerprüfung
- Das Finanzamt prüft automatisch: Kindergeld vs. Kinderfreibetrag.
- Es wird immer die Variante gewählt, die den Eltern finanziell mehr bringt.
- Kindergeld wird monatlich ausgezahlt, der Freibetrag wirkt erst mit dem Steuerbescheid.
4. Beispiele
- Familie mit mittlerem Einkommen → Kindergeld vorteilhaft.
- Familie mit sehr hohem Einkommen → Freibetrag bringt steuerlich mehr.
- Alleinerziehende können zusätzlich den Entlastungsbetrag geltend machen.
5. Tipps & Hinweise
- Kindergeld wird immer ausgezahlt, auch wenn der Freibetrag später günstiger ist.
- Bei mehreren Kindern summieren sich Freibeträge und Kindergeld entsprechend.
- Änderungen (Ausbildung, Studium, Auszug) rechtzeitig der Familienkasse melden.
Kindergeld & Freibeträge – schnelle Orientierung
- Kindergeld: 250 € pro Monat je Kind
- Freibeträge 2025: 6.612 € + 2.928 € BEA pro Kind
- Günstigerprüfung: Finanzamt wählt automatisch die bessere Variante
Hinweis: Diese Übersicht ersetzt keine individuelle Steuerberatung.
Besonders bei hohen Einkommen lohnt eine genaue Prüfung.
Kleinunternehmer
Kleinunternehmerregelung – schnelle Orientierung (ab 2025)
- Umsatz im Vorjahr ≤ 25.000 € (statt bisher 22.000 €)
- Umsatz im laufenden Jahr voraussichtlich ≤ 100.000 € (statt bisher 50.000 €)
- Keine Umsatzsteuer auf Rechnungen → einfacher Verwaltungsaufwand
- Kein Vorsteuerabzug möglich → nachteilig bei hohen Eingangsleistungen
- Option zur Regelbesteuerung auf Antrag möglich (Bindung mind. 5 Jahre)
Hinweis: Neue Umsatzgrenzen gelten ab 01.01.2025. Für 2024 gilt noch die alte Grenze von 22.000 € / 50.000 €.
Krypto-Währung
|
🔍 Kryptosteuer-Schnellcheck
Ist dein Kryptogewinn steuerfrei oder steuerpflichtig?Mit diesem kleinen Rechner kannst du in wenigen Sekunden prüfen, ob ein einzelnes Kryptogeschäft voraussichtlich unter die Steuer fällt – oder ob du entspannt durchatmen darfst.
💸 Kryptotransaktion prüfen
Bitte trage ein einzelnes Geschäft ein (Kauf → Verkauf / Tausch).
Privatvermögen
Wichtiger Hinweis:
Dieser Rechner ist eine stark vereinfachte Orientierung zu privaten Veräußerungsgeschäften nach § 23 EStG. Die tatsächliche steuerliche Beurteilung kann im Einzelfall abweichen (insbesondere bei Staking/Lending/Mining, beruflicher Nutzung oder häufigem Handel). Keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall – sprich uns bei größeren Beträgen bitte direkt an. |
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
Dauer
Bis zu 6 Wochen (42 Tage) je Krankheit.
Höhe
Arbeitgeber zahlt 100 % des Entgelts während EFZG.
Blockfrist
Krankengeld max. 78 Wochen in 3 Jahren je Krankheit.
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
Die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall (Entgeltfortzahlung, EFZG) regelt, wann und wie lange ein Arbeitnehmer
bei Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf Lohnzahlung durch den Arbeitgeber hat.
1. Grundsatz (Entgeltfortzahlungsgesetz, EFZG)
- Dauer: bis zu 6 Wochen (42 Kalendertage) pro Krankheit.
- Voraussetzung: Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit, unverzüglich gemeldet und ärztlich bescheinigt.
- Höhe: 100 % des bisherigen Arbeitsentgelts.
2. Wiedererkrankung derselben Krankheit
- Anrechnung: Alle Zeiträume mit derselben Krankheit werden zusammengerechnet.
- Neuer Anspruch auf 6 Wochen, wenn:
- mindestens 6 Monate ohne Arbeitsunfähigkeit durch diese Krankheit vergangen sind, oder
- seit Beginn der ersten AU wegen dieser Krankheit 12 Monate vergangen sind.
3. Krankengeld nach Ablauf der 6 Wochen
- Ab Tag 43 übernimmt die Krankenkasse mit Krankengeld:
- Höhe: ca. 70 % des Brutto-, max. 90 % des Nettoentgelts.
- Auszahlung in der Regel für max. 78 Wochen innerhalb von 3 Jahren pro Krankheit.
- Blockfrist: 3 Jahre ab Beginn der ersten AU wegen dieser Krankheit.
4. Besonderheiten
- Mehrere Erkrankungen gleichzeitig: Jede Erkrankung hat ihren eigenen 6-Wochen-Zeitraum.
- Hinzutretende Krankheit: verlängert den Anspruch nicht.
- Tarif-/Arbeitsvertrag: können abweichende, z. T. günstigere Regelungen enthalten.
5. Praxis-Hinweise
- Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) muss unverzüglich vorgelegt werden.
- Arbeitgeber kann nach § 5 Abs. 1 EFZG auch ab dem ersten Krankheitstag ein Attest verlangen.
- Dokumentation der AU-Zeiträume ist wichtig (z. B. mit unserem
Krankengeld-Tool).
Krankengeld – schnelle Orientierung
- 42 Tage Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber
- Ab Tag 43 zahlt die Krankenkasse Krankengeld
- Maximal 78 Wochen in 3 Jahren pro Krankheit
- Neuer Anspruch nach 6 Monaten ohne AU oder 12 Monaten seit Beginn
Hinweis: Arbeitshilfe – keine Rechtsberatung; individuelle Abweichungen je nach Tarif-/Arbeitsvertrag möglich.
Mindestlohn
💶 Gesetzlicher Mindestlohn (DE)
Kanzlei-Wiki • Stand: Oktober 2025
Aktueller Wert & beschlossene Erhöhungen siehe nächste Abschnitte.
| Seit | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | 12,82 € / Stunde | Gilt allgemein (mit Ausnahmen gem. MiLoG). „Übergangsbereich/Midijob“ & Minijob-Grenze richten sich dynamisch mit. |
Quelle: Bundesregierung/BMAS – Beschlusslage & FAQ (2025).
| Datum | Stundenlohn | Änderung | Kumuliert ab 2025 |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 13,90 € | +8,42 % | +8,42 % |
| 01.01.2027 | 14,60 € | +5,04 % | +13,88 % |
Quintessenz: Deutlicher Push im Niedriglohnbereich; Arbeitgeber sollten Lohnbänder & Budgets rechtzeitig anpassen.
| Jahr | Mindestlohn | Monatliche Minijob-Grenze | Übergangsbereich (Midijob) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12,82 € | 556 € | 556,01 € – 2.000 € |
| 2026 | 13,90 € | 603 € | 603,01 € – 2.000 € |
| 2027 | 14,60 € | 633 € | ab 633,01 € – 2.000 € (politisch ggf. anpassbar) |
Praxis: Arbeitszeitmodelle & Verträge prüfen (z. B. ≈ 43–45 Std/Monat bei Minijobs 2026).
| ab | € / Std. | Bemerkung |
|---|---|---|
| 01.01.2015 | 8,50 | MiLoG-Start |
| 01.10.2022 | 12,00 | gesetzl. Sprunganhebung |
| 01.01.2024 | 12,41 | Regelanpassung |
| 01.01.2025 | 12,82 | Regelanpassung |
| 01.01.2026 | 13,90 | Beschluss Mindestlohnkommission |
| 01.01.2027 | 14,60 | Beschluss Mindestlohnkommission |
Detailtabellen & Quellen: BMAS/BReg/DESTATIS.
- Lohnbänder & Verträge aktualisieren (Stunden-/Monatsmodelle, Zuschläge, Praktika/Minijobs).
- Arbeitszeiterfassung sauber führen (Dokumentationspflichten in bestimmten Branchen).
- Budgets (Personalkosten, Preislisten) ab 2026/2027 fortschreiben.
- Midijob-Prüfung: Vorteilhaftigkeit für AG/AN rechnen (Beitragslast & Nettoeffekt).
- Abhängige Grenzwerte (Stundenkontingente, Ziel-Gehälter) neu dimensionieren.
| Thema | Bewertung | Hinweis |
|---|---|---|
| Unterschreitung MiLoG | Risiko | Nachzahlung, Bußgeld, Zinsen |
| Doku-Pflichten | Achten | Branchenabhängig (z. B. § 17 MiLoG/Schwarzarbeit) |
| Planung 2026/27 | Empfohlen | Budget & Systeme vorbereiten |
Wer hat Anspruch?
Grundsätzlich alle Arbeitnehmer:innen. Ausnahmen u. a. bestimmte Praktika, Minderjährige ohne abgeschlossene Berufsausbildung.
Brutto oder Netto?
Brutto-Stundenlohn. Netto hängt von Steuer-/SV-Abzügen ab.
Probezeit/Teilzeit/Minijob?
Der Mindestlohn gilt unabhängig von Probezeit und Beschäftigungsumfang; bei Minijobs Grenzen beachten (s. oben).
Umsetzung der Erhöhungen?
Beschluss der Mindestlohnkommission → BMAS-Rechtsverordnung. Ab 01.01.2026: 13,90 €; ab 01.01.2027: 14,60 € (Stand: Beschluss 27.06.2025).
| Aussage | Ergebnis |
|---|---|
| Mindestlohn 2025 | 12,82 € |
| ab 01.01.2026 | 13,90 € |
| ab 01.01.2027 | 14,60 € |
| Minijob-Grenze (2026/2027) | ≈ 603 € / 633 € mtl. |
| To-do für Arbeitgeber | Lohnbänder, Verträge, Zeiterfassung, Budgets updaten |
minijob
🧾 Geringfügige Beschäftigung & Midijobs 2025/2026
Kanzlei-Wiki • Stand: Oktober 2025
Kurzfristige Beschäftigungen (max. 3 Monate / 70 Tage p.a.) sind gesondert zu betrachten – keine Minijobs!
Die Minijob-Grenze berechnet sich dynamisch nach folgender Formel:
10 Std/Woche × Mindestlohn × 13 / 3 → gerundet auf volle €.
| Jahr | Mindestlohn | Monatliche Minijob-Grenze | Übergangsbereich (Midijob) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12,82 € | 556 € | 556,01 € – 2.000 € |
| 2026 | 13,90 € | 603 € | 603,01 € – 2.000 € |
| 2027 | 14,60 € | 633 € | ab 633,01 € – 2.000 € |
Die Grenzen steigen automatisch mit dem Mindestlohn – Arbeitgeber sollten Verträge und Stundenmodelle prüfen.
| Jahr | Stunden/Monat | Stundenlohn | Brutto | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43 Std | 12,82 € | ≈ 552 € | Minijob |
| 2026 | 43 Std | 13,90 € | ≈ 598 € | Minijob |
| 2026 | 46 Std | 13,90 € | ≈ 639 € | > Grenze |
Sonderzahlungen (Urlaub, Weihnachtsgeld, Boni) sind einzubeziehen – sie können zur Überschreitung führen.
| Aspekt | Minijob | Midijob |
|---|---|---|
| Krankenversicherung | keine AN-Beiträge; AG-Pauschale 13 % (gewerblich) | AN-Beitrag reduziert, AG voll |
| Rentenversicherung | pflichtig (AN 3,6 %), Befreiung möglich | pflichtig, mit reduzierten AN-Beiträgen |
| Arbeitslosen-/Pflegeversicherung | nicht anwendbar | pflichtig (reduzierte AN-Beiträge) |
| Steuer | Pauschal 2 % (inkl. KV/RV) oder ELStAM | nach ELStAM (normale Lohnsteuer) |
| Meldestelle | Minijob-Zentrale | zuständige Krankenkasse |
Bei mehreren Minijobs erfolgt Zusammenrechnung – Gesamtentgelt entscheidet über Status.
- 💡 Entgeltplanung: Regelmäßiges Monatsentgelt realistisch prognostizieren (inkl. Sonderzahlungen).
- 🧾 RV-Befreiung: Nur mit schriftlichem Antrag – Nachweis ablegen!
- 📅 Arbeitszeit: Vertraglich festlegen (ca. 40–44 Std/Monat ≈ Minijob).
- 🧮 Grenzprüfung: Monatlich überwachen (Stundenzettel / Lohnabrechnung).
- 📊 Mehrfachjobs: Beschäftigungen summieren – SV-Status neu prüfen.
| Fehlerquelle | Risiko | Hinweis |
|---|---|---|
| Grenzübertritt durch Bonus | Hoch | Puffer lassen – ggf. Midijob anmelden. |
| RV-Befreiung fehlt | Mittel | Nachträgliche Beiträge, keine Rückwirkung. |
| Falsche Einstufung | Mittel | Statusprüfung / Probeabrechnung. |
| Punkt | Ergebnis |
|---|---|
| Minijob-Grenze 2025 | 556 € |
| Minijob-Grenze 2026 | 603 € |
| Minijob-Grenze 2027 | 633 € |
| Midijob-Bereich | ab Grenze + 0,01 € bis 2.000 € |
| Praxis-Tipp | Grenzen monatlich prüfen, RV-Antrag dokumentieren, Verträge anpassen. |
Quellen: BMAS, Minijob-Zentrale, SGB IV. – Zahlen 2026/2027 vorbehaltlich endgültiger Mindestlohn-Verordnung.
Minijob, Midijob & Krankenversicherungspflicht
Minijob, Midijob & Krankenversicherungspflicht
Geringfügige Beschäftigungen (Minijob, Midijob) und die Krankenversicherungspflicht
orientieren sich an festen Verdienst- und Beitragsgrenzen.
Diese ändern sich regelmäßig – ab 2026 ist eine deutliche Anhebung geplant.
1. Minijob
- Verdienstgrenze: 538 € pro Monat (Stand 2025).
- Pauschale Abgaben vom Arbeitgeber (Renten-, Krankenversicherung, Umlagen).
- Arbeitnehmer meist versicherungsfrei, außer in der Rentenversicherung (Opt-out möglich).
- Steuer pauschal oder nach Lohnsteuerkarte – oft steuerfrei für den Arbeitnehmer.
2. Midijob (Übergangsbereich)
- Verdienst zwischen 538,01 € und 2.000 € (Stand 2025).
- Sozialabgaben steigen gleitend mit dem Einkommen.
- Arbeitnehmer zahlt weniger Beiträge, volle Rentenansprüche bleiben erhalten.
- Für viele Arbeitnehmer attraktiver als klassischer Minijob.
3. Krankenversicherungspflicht
- Bis zur Beitragsbemessungsgrenze (BBG) sind Arbeitnehmer pflichtversichert in der GKV.
- BBG Krankenversicherung 2025: 5.175 € / Monat (62.100 € / Jahr).
- Darüber: Möglichkeit zum Wechsel in die private Krankenversicherung (PKV).
4. Geplante Änderungen ab 2026
- BBG Krankenversicherung: soll auf ca. 5.812,50 € / Monat (69.750 € / Jahr) steigen.
- BBG Rentenversicherung (West): soll auf ca. 8.450 € / Monat angehoben werden.
- Ziel der Reform: mehr Beitragseinnahmen für die Sozialversicherungen.
- Für Gutverdiener bedeutet das: ab 2026 höhere Abgaben auf das Einkommen.
- ⚠️ Stand jetzt: Diese Werte stammen aus Referentenentwürfen, noch nicht endgültig beschlossen.
5. Tipps & Hinweise
- Minijobber sollten prüfen, ob ein Midijob langfristig mehr Vorteile bringt.
- Arbeitgeber müssen die neuen Grenzen ab 2026 genau im Blick behalten.
- Wechsel in die PKV gut überlegen – Rückkehr in die GKV ist später oft schwierig.
Minijob, Midijob & KV – schnelle Orientierung
- Minijob: bis 538 € / Monat
- Midijob: 538,01 – 2.000 € / Monat
- GKV-Pflicht 2025: bis 5.175 € / Monat
- BBG ab 2026 geplant: 5.812,50 € (KV) / 8.450 € (RV)
Hinweis: Diese Übersicht ersetzt keine individuelle Beratung.
Änderungen ab 2026 sind politisch beschlossen, aber noch nicht endgültig im Gesetz verankert.
Muss ich alle Belege digitalisieren oder reicht Papier?
Muss ich alle Belege digitalisieren oder reicht Papier?
Grundsätzlich können Belege in Papierform oder digital aufbewahrt werden.
In der Praxis ist die digitale Variante jedoch klar im Vorteil.
Empfehlung
- Alle Belege einscannen oder fotografieren (PDF/JPG)
- Archivierung im DATEV Unternehmen online (DUO)
- Papier kann zusätzlich aufbewahrt werden – ist aber nicht zwingend erforderlich
Mini-Checkliste
Wichtig: GoBD
Die GoBD schreiben vor, dass Belege unveränderbar, vollständig und nachvollziehbar
archiviert werden müssen.
Nur dann sind sie auch bei einer Betriebsprüfung anerkannt.
Mutterschutz & Mutterschaftsgeld
Mutterschutz & Mutterschaftsgeld
Der Mutterschutz sichert werdende und frischgebackene Mütter durch besondere Schutzfristen
und finanzielle Leistungen ab. Arbeitgeber, Krankenkassen und Staat teilen sich die Leistungen.
Auf einen Blick
6 Wochen vor & 8 Wochen nach Geburt
Mutterschaftsgeld: 13 €/Tag von der Krankenkasse
Arbeitgeber zahlt Aufstockung bis zum Netto
1. Schutzfristen
- 6 Wochen vor dem voraussichtlichen Entbindungstermin.
- 8 Wochen nach der Geburt (bei Früh-/Mehrlingsgeburten: 12 Wochen).
- In dieser Zeit besteht ein Beschäftigungsverbot.
2. Mutterschaftsgeld
- Gesetzlich versicherte Arbeitnehmerinnen: max. 13 €/Tag von der Krankenkasse.
- Privatversicherte oder familienversicherte Arbeitnehmerinnen: einmalig bis 210 € vom Bundesamt für Soziale Sicherung.
- Antrag über die Krankenkasse / Arbeitgeber.
3. Arbeitgeber-Zuschuss
- Arbeitgeber stockt das Mutterschaftsgeld auf den Nettolohn auf.
- Berechnung nach dem durchschnittlichen Netto der letzten 3 abgerechneten Monate.
- Der Zuschuss wird dem Arbeitgeber über die Umlage (U2-Verfahren) von der Krankenkasse erstattet.
4. Besonderheiten
- Beschäftigungsverbot vorzeitig möglich, wenn ärztlich bescheinigt.
- Kündigungsschutz von Beginn der Schwangerschaft bis 4 Monate nach Entbindung.
- Nach Ablauf des Mutterschutzes: Übergang in Elternzeit / Elterngeld.
5. Praxis-Hinweise
- Ärztliche Bescheinigung des voraussichtlichen Geburtstermins notwendig.
- Antragstellung rechtzeitig bei der Krankenkasse.
- Netto-Berechnung beim Arbeitgeber prüfen.
Mutterschutz – schnelle Orientierung
- 6 Wochen vor der Geburt Schutzfrist (freiwillige Beschäftigung möglich)
- 8 Wochen nach der Geburt (bei Früh-/Mehrlingsgeburten 12 Wochen)
- Mutterschaftsgeld durch Krankenkasse + Arbeitgeberzuschuss
- Besonderer Kündigungsschutz während Schwangerschaft & Mutterschutz
Hinweis: Diese Übersicht ersetzt keine Rechtsberatung; Abweichungen durch Tarifvertrag möglich.
Nachlassplanung
Nachlassplanung
Eine kluge Nachlassplanung sorgt dafür, dass Vermögen nicht unnötig durch Steuern geschmälert wird.
Wer frühzeitig gestaltet, kann Freibeträge mehrfach nutzen, steuerliche Begünstigungen sichern
und Konflikte unter Erben vermeiden.
1. Vorteile einer Nachlassplanung
- Steueroptimierung: Freibeträge durch Schenkungen alle 10 Jahre mehrfach nutzen.
- Familienheim: im Erbfall oft steuerfrei – bei Kindern bis 200 qm Wohnfläche.
- Betriebsvermögen: steuerlich begünstigt, wenn bestimmte Voraussetzungen eingehalten werden.
- Reibungsloser Übergang: klare Regelungen verhindern Streit unter Erben.
2. Typische Instrumente
- Schenkungen: gezielte Vorabübertragungen, um Freibeträge auszuschöpfen.
- Testament & Erbvertrag: klare Verteilung und Vermeidung von Pflichtteilsproblemen.
- Nießbrauch & Wohnrechte: Vermögen übertragen, aber Nutzung sichern.
- Versicherungen & Gesellschaftsverträge: auf die Nachfolge abstimmen.
3. Typische Fehler
- Freibeträge nicht genutzt → hohe Steuerlast im Erbfall.
- Familienheim zu Lebzeiten auf Kinder übertragen → keine Befreiung.
- Betriebsvermögen ohne Behaltensregelungen übertragen → Nachversteuerung droht.
- Erbanteile unklar geregelt → Streit und Zerschlagung des Vermögens.
4. Praxis-Tipps
- Schenkungen frühzeitig planen → 10-Jahres-Regel mehrfach nutzen.
- Familienheim: meist günstiger im Erbfall übertragen.
- Betriebsvermögen: Fachberatung zwingend einbeziehen.
- Regelmäßig prüfen – Gesetze & persönliche Situation ändern sich.
Nachlassplanung – schnelle Orientierung
- Freibeträge: alle 10 Jahre nutzbar
- Familienheim: steuerfrei im Erbfall (mit Bedingungen)
- Betriebsvermögen: begünstigt, aber an Auflagen gebunden
Hinweis: Diese Übersicht ersetzt keine individuelle Beratung.
Bei komplexen Vermögen sollte ein Steuerberater oder Fachanwalt einbezogen werden.
Neue Mitarbeiter anmelden: Diese Unterlagen brauchst du
Neue Mitarbeiter anmelden: Diese Unterlagen brauchst du
Bevor ein neuer Mitarbeiter seine Tätigkeit aufnimmt, sind bestimmte Unterlagen notwendig,
damit die Anmeldung bei Sozialversicherung und Finanzamt korrekt erfolgen kann.
Benötigte Unterlagen
- Arbeitsvertrag
- Steuer-ID
- Sozialversicherungsnummer
- Krankenkasse (Mitgliedsbescheinigung)
- Bankverbindung
Wichtige Frist
Die Anmeldung muss vor Arbeitsbeginn erfolgen!
Verspätete Meldungen können zu Bußgeldern und Problemen mit der Lohnabrechnung führen.
Noch praktischer
👉 Nutze unsere interaktive
Checkliste zur Lohn-Neuanmeldung, um alle Unterlagen abzuprüfen und nichts zu vergessen.
Nießbrauch
WIKI: NIEßBRAUCH – STEUERLICHE & RECHTLICHE GRUNDLAGEN
Nießbrauch trennt Eigentum und Nutzung – beliebt bei Immobilien, Unternehmen und in der Nachfolge.
Kurzfazit
- Nießbrauch = Nutzung fremden Eigentums + Ziehung der Erträge.
- Wichtig in der Vermögens- & Unternehmensnachfolge.
- Steuerlich: Einkünfte beim Nießbraucher, Eigentum beim Übertragenden.
💡 Typisch: Eltern übertragen Immobilie auf Kinder, behalten Nießbrauch & Mieteinnahmen.
Arten des Nießbrauchs
- Vorbehaltsnießbrauch: Eigentum übertragen, Nutzung behalten.
- Zuwendungsnießbrauch: Eigentümer räumt Dritten Nutzung ein.
- Bruchteilsnießbrauch: z. B. 50 % der Mieten.
- Gesellschaftsanteile: GmbH-/KG-Anteile übertragen, Erträge beim Übergeber.
Steuerliche Aspekte
- Einkommensteuer: Nießbraucher versteuert Einkünfte.
- Schenkung-/Erbschaftsteuer: Wert des übertragenen Vermögens wird durch Nießbrauch gemindert.
- Grunderwerbsteuer: Familienübertragungen oft steuerfrei, Nießbrauch muss ins Grundbuch.
- Bewertung: Kapitalwert nach Lebenserwartung (§ 14 BewG).
⚠️ Bei Betriebsvermögen sind steuerliche Stolperfallen (gewerbliche Infektion) möglich.
Praxis-Beispiele
Immobilien
Eltern übertragen Haus an Kinder, behalten Nießbrauch → Kinder sind Eigentümer, Eltern erhalten Mieten.
GmbH-Anteile
Anteile übertragen, Gewinne per Nießbrauch beim Übergeber, Stimmrechte individuell geregelt.
Zuwendungsnießbrauch
Eltern übertragen Nießbrauch an Wertpapierdepot auf Kinder → Nutzung des niedrigeren Steuersatzes.
Vor- & Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Erhalt der Nutzungen (Mieten, Dividenden) | Komplex, notarielle Beurkundung nötig |
| Steuerersparnis durch Wertminderung | Schwer auflösbar, Bindung auf Lebenszeit |
| Nachfolgeplanung ohne Kontrollverlust | Potenzielle Konflikte zwischen Eigentümer & Nießbraucher |
Checkliste vor Nießbrauchsgestaltung
FAQ: Häufige Fragen
Wie lange gilt ein Nießbrauch?
Grundsätzlich lebenslang, außer befristet vereinbart.
Kann ein Nießbrauch gelöscht werden?
Nur mit Zustimmung von Eigentümer & Nießbraucher; bei Immobilien durch Grundbuchänderung.
Warum beliebt bei Immobilien?
Weil Eigentum übertragen wird, aber die wirtschaftliche Nutzung (Mieten) beim Übertragenden bleibt.
Pendlerpauschale
Pendlerpauschale – schnelle Orientierung
- 0,30 € pro Entfernungskilometer ab dem 1. bis 20. km
- 0,38 € pro Entfernungskilometer ab dem 21. km
- Gilt für Arbeitstage – einfache Strecke Wohnung ↔ Arbeitsstätte
- Unabhängig vom Verkehrsmittel (Auto, Bahn, Fahrrad, zu Fuß)
- Absetzbar als Werbungskosten in der Steuererklärung
Hinweis: Tatsächliche Kosten (z. B. Bahncard, Sprit) sind unerheblich – die Pauschale gilt unabhängig davon.
Phantomlohn & Zeitkonten
💼 Phantomlohn & Zeitkonten – Sozialversicherungsrechtliche Behandlung
Kanzlei-Wiki • Stand: Oktober 2025
Von Phantomlohn spricht man, wenn ein Arbeitnehmer einen Anspruch auf Entgelt hat,
dieser aber nicht ausgezahlt oder abgerechnet wird – etwa durch fehlerhafte Lohnabrechnung.
In der Sozialversicherung werden Beiträge auf alles erhoben, was dem Arbeitnehmer zusteht,
auch wenn es (noch) nicht gezahlt wird (§ 22 SGB IV).
Bei Zeitkonten oder kurzfristiger Überstundenansparung ist entscheidend,
ob der Anspruch bereits fällig ist oder nur „ruhend“ geführt wird.
Nur im ersten Fall entsteht ein beitragspflichtiger Phantomlohn.
Im hier behandelten Fall werden Überstunden auf einem Konto gesammelt und später in Geld ausgezahlt.
Es handelt sich nicht um ein Langzeit- oder Wertguthabenkonto nach § 7b SGB IV.
| Merkmal | Ausprägung |
|---|---|
| Art der Stunden | Überstunden aus laufender Beschäftigung |
| Verwendung | Spätere Auszahlung in Geld (nicht Freizeit) |
| Rechtsgrundlage | Tarifvertrag / Arbeitsvertrag |
| Ausweis auf Lohnabrechnung | Nein, nur interne Zeiterfassung |
➡️ Solange die Stunden nur angespart und noch nicht fällig sind,
entsteht keine Beitragspflicht in der Sozialversicherung.
🔹 Kein Phantomlohn in der Ansparphase
Nach § 14 SGB IV und § 22 SGB IV sind Beiträge erst abzuführen,
wenn das Arbeitsentgelt fällig ist.
Bei tariflich geregelten Zeitkonten ist die Fälligkeit ausdrücklich verschoben –
somit liegt kein beitragspflichtiges Entgelt vor.
🔹 Beitragspflicht erst bei Auszahlung
Die Sozialversicherungspflicht entsteht erst im Monat der Auszahlung der Überstundenvergütung.
Dann sind die Beträge ganz normal als laufendes Arbeitsentgelt zu verbeitragen.
| Phase | Beitragspflicht | Begründung |
|---|---|---|
| Ansparung (Überstundenkonto) | Nein | Kein fälliger Anspruch, tariflich aufgeschoben |
| Auszahlung | Ja | Zufluss des Entgelts → beitragspflichtig |
- BSG, Urteil vom 10. 12. 2019 – B 12 R 9/18 R
Beitragsanspruch entsteht erst bei arbeitsrechtlicher Fälligkeit. - BAG, Urteil vom 24. 02. 2016 – 5 AZR 258/15
Arbeitszeitkonto begründet erst mit Freistellung oder Auszahlung einen Vergütungsanspruch. - DRV Rundschreiben 03/2021
Kurzfristige tarifliche Überstundenkonten sind beitragsfrei in der Ansparphase.
- Tarifvertrag / Arbeitsvertrag immer als Nachweis bereithalten (Fälligkeitsregelung).
- Stundenkonto nur intern führen, nicht als Entgeltbestandteil auf der Lohnabrechnung.
- Auszahlung eindeutig dokumentieren („Auszahlung Überstunden Mai im Juli 2025“).
- Keine Geldwert-Umrechnung während der Ansparphase → sonst droht fiktives Entgelt.
| Bewertung | Ergebnis |
|---|---|
| Beitragspflicht bei Ansparung | Nein |
| Beitragspflicht bei Auszahlung | Ja, im Monat der Zahlung |
| Phantomlohngefahr | Keine – tariflich gedeckt |
| Rechtsgrundlagen | § 14, § 22 SGB IV | BSG 10.12.2019 – B 12 R 9/18 R |
Photovoltaikanlage
☀️ Photovoltaikanlagen ab 2023 – Steuerfrei & 0 % USt
Kanzlei-Wiki • Stand: Oktober 2025
Seit dem JStG 2022 (ab 01.01.2023) sind kleine PV-Anlagen stark entbürokratisiert:
Ertragsteuerfrei bis zu definierten kWp-Grenzen und
0 % Umsatzsteuer für Lieferung & Installation im Wohnumfeld.
§ 12 Abs. 3 UStG (0 % USt)
§ 35a / § 35c – Wahlrecht
Gilt für Neu- und viele Erweiterungsfälle; Spezialfälle (Altanlagen, Betreiberwechsel, Mieterstrom) gesondert prüfen.
| Regelung | Ab 2023 | Hinweis |
|---|---|---|
| PV bis 30 kWp je Einheit | steuerfrei | Keine EÜR, keine AfA – Einnahmen bleiben außer Ansatz |
| Mehrere Anlagen (Summe) | bis 100 kWp | Gesamtleistung maßgeblich |
| MFH-Orientierung | 15 kWp je Einheit | Verwaltungspraxis; Einzelfall prüfen |
Steuerfreiheit unabhängig von Eigenverbrauch oder Volleinspeisung.
| Leistung | USt-Regelung | Hinweis |
|---|---|---|
| Lieferung & Installation im Wohnumfeld | 0 % USt | Auch gebäudenah (Garage/Carport) |
| Speicher / Wechselrichter | 0 % USt | Im Zusammenhang mit PV (bzw. Nachrüstung) |
| Wallbox | oft 0 % | Bei PV-Zusammenhang möglich; sonst 19 % |
0 %-Lieferung = keine Vorsteuer; i. d. R. keine USt-Voranmeldungen.
| Maßnahme | Begünstigung | Hinweis |
|---|---|---|
| PV inkl. Speicher | ESt steuerfrei + 0 % USt | Standardfall Privatbereich |
| PV + Wallbox | 0 % USt möglich | PV-Zusammenhang dokumentieren |
| PV-Montage | § 35a möglich | Nur Arbeitskosten; keine Doppelförderung mit § 35c |
| Energetische Sanierung | § 35c möglich | Alternativ zu § 35a (für dieselbe Maßnahme) |
| Position | Betrag | Steuer |
|---|---|---|
| PV Komplett (10 kWp) | 12 000 € | 0 % USt |
| Arbeitslohnanteil | 3 500 € | § 35a möglich |
| Einspeisevergütung p. a. | 900 € | ESt steuerfrei |
- Rechnung mit 0 %-Hinweis (§ 12 Abs. 3 UStG) prüfen.
- Leistungsdaten (kWp) & Einheiten dokumentieren.
- PV-Zusammenhang für Speicher/Wallbox festhalten.
- § 35a vs. § 35c abwägen – nicht kombinieren.
| Punkt | Ergebnis |
|---|---|
| Einkommensteuer | steuerfrei bis 30 kWp je Einheit; max. 100 kWp gesamt |
| Umsatzsteuer | 0 % auf Lieferung/Installation im Wohnumfeld |
| Arbeitskosten | § 35a möglich (ohne Förderung) |
| Energetische Sanierung | § 35c als Alternative (nicht parallel) |
Interaktiver Quick-Check: ESt-Befreiung, 0 % USt und § 35a/§ 35c-Hinweise.
Rechnungen richtig erstellen: Pflichtangaben im Überblick
Pflichtangaben auf Rechnungen
- Name und Anschrift des Ausstellers und des Empfängers
- Steuernummer oder USt-IdNr. des Ausstellers
- Ausstellungsdatum der Rechnung
- Fortlaufende Rechnungsnummer (eindeutig, ohne Lücken)
- Menge und Art der gelieferten Gegenstände bzw. Art & Umfang der Leistung
- Nettobetrag (Entgelt ohne USt)
- Umsatzsteuersatz (z. B. 19 % / 7 %) und Umsatzsteuerbetrag in €
- Bruttobetrag (Endbetrag inkl. USt)
vereinfachte Angaben ausreichend (u. a. keine Steuernummer/USt-IdNr., aber Name/Anschrift, Datum, Art/Menge, Bruttobetrag und USt-Satz erforderlich).
Wichtige Sonderfälle (Zusatzvermerke):
-
Reverse-Charge (Leistung an Unternehmer mit § 13b UStG):
Zusatz auf der Rechnung:
„Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (Reverse-Charge)“.
Umsatzsteuer nicht ausweisen. -
Innergemeinschaftliche Lieferung (Waren in anderes EU-Land):
Zusatz:
„Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung“;
USt-IdNr. beider Parteien angeben. -
Ausfuhrlieferung (Export):
Zusatz:
„Steuerfreie Ausfuhrlieferung nach § 4 Nr. 1 a i. V. m. § 6 UStG“. -
Steuerfreie Umsätze (z. B. Heilbehandlung, Vermietung):
Zusatz:
„Umsatz steuerfrei – Befreiungstatbestand: § … UStG“
(konkrete Norm angeben); keine USt ausweisen. -
Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG):
Zusatz:
„Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.“ -
Gutschrift (Self-Billing):
Rechnung muss das Wort „Gutschrift“ enthalten und die
USt-IdNr./Steuernummer des Leistungserbringers; übrige Pflichtangaben wie oben.
Praxis-Tipp: Verwende Textbausteine in deinem Rechnungsprogramm für die obigen Vermerke, um Fehler zu vermeiden.
Rentenformen
Altersvorsorgeaufwendungen
Altersvorsorgeaufwendungen sind Beiträge zur Absicherung im Alter.
Dazu gehören die gesetzliche Rentenversicherung, die Rürup- (Basisrente) und Riester-Rente.
Sie sind steuerlich begünstigt – die spätere Auszahlung unterliegt jedoch der nachgelagerten Besteuerung.
1. Gesetzliche Rentenversicherung
- Pflichtbeiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern.
- Seit VZ 2023: 100 % der Beiträge sind steuerlich abzugsfähig.
- Beiträge zählen zur sogenannten Basisversorgung.
- Spätere Rentenzahlungen → steuerpflichtig (Besteuerungsanteil abhängig vom Rentenbeginn, bis 2040 = 100 %).
2. Rürup-Rente (Basisrente)
- Besonders geeignet für Selbstständige, Freiberufler & Gutverdiener.
- Sehr hohe steuerliche Förderung:
– Seit VZ 2023 sind 100 % der Beiträge absetzbar.
– Maximal abzugsfähiger Beitrag 2025: ca. 29.344 € pro Person (ledig), doppelt bei Ehegatten. - Beiträge mindern direkt das zu versteuernde Einkommen → oft spürbare Steuerersparnis.
- Auszahlung nur als lebenslange Rente, kein Kapitalwahlrecht.
- Besteuerung in der Rentenphase: nachgelagert, Anteil steigt bis 2040 auf 100 %.
3. Riester-Rente
- Förderung durch Zulagen (175 € Grundzulage + Kinderzulagen).
- Zusätzlich Sonderausgabenabzug bis max. 2.100 €.
- Geeignet vor allem für Familien mit Kindern und Arbeitnehmer in der GKV.
- Auszahlungen → steuerpflichtig (nachgelagerte Besteuerung), bis zu 30 % Kapitalentnahme möglich.
4. Steuerliche Aspekte
- Beiträge: senken die Steuerlast (Sonderausgaben).
- Auszahlungen: nachgelagerte Besteuerung (Renten voll steuerpflichtig ab 2040).
- Die Steuerersparnis in der Einzahlungsphase ist erheblich, insbesondere bei hohen Einkommen.
- Strategisch nutzen: hohe Beiträge in Jahren mit hoher Steuerprogression besonders vorteilhaft.
5. Tipps & Hinweise
- Rürup eignet sich zur Steueroptimierung – vor allem für Selbstständige und Gutverdiener.
- Riester lohnt sich häufig bei Kindern und geringeren Einkommen.
- Auszahlungsphase bedenken: Renten sind steuerpflichtig, Freibeträge prüfen.
- Kombination mit betrieblicher Altersvorsorge kann sinnvoll sein.
Altersvorsorgeaufwendungen – schnelle Orientierung
- Gesetzliche Rente: Pflichtbeiträge, seit VZ 2023 zu 100 % absetzbar
- Rürup-Rente: bis ca. 29.344 € (2025) voll absetzbar
- Riester-Rente: Zulagen + bis 2.100 € Sonderausgabenabzug
- Auszahlungen: nachgelagerte Besteuerung
Hinweis: Diese Übersicht ersetzt keine individuelle Beratung.
Die Steuerersparnis durch Rürup ist erheblich – Auszahlungsphase unbedingt mitplanen.
Rentenformen – Vergleich auf einen Blick
Quellen: Deutsche Rentenversicherung/BMF (Rentenbesteuerung); BMF LStR & TK (bAV-Freibeträge); DRV/BMF (Riester-Zulagen); Praxiswerte Basisrente 2025.
Rentenversicherungspflicht Selbstständige
👩⚕️ Rentenversicherungspflicht Selbstständige / Dozenten / Hebammen (§ 2 SGB VI)
Kanzlei-Wiki • Stand: Oktober 2025
Nach § 2 SGB VI sind bestimmte selbstständig Tätige kraft Gesetzes rentenversicherungspflichtig, wenn sie auf Dauer und im Wesentlichen ohne Beschäftigte tätig sind. Ziel ist die Absicherung typischer Allein-Selbstständiger wie Lehrer, Dozenten, Pflegepersonen oder Hebammen.
Pflichtversicherung kraft Gesetzes
Ausnahme → Befreiung § 6 SGB VI
Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) prüft im Rahmen der Statusfeststellung (§ 7a SGB IV), ob eine abhängige Beschäftigung oder eine selbstständige, versicherungspflichtige Tätigkeit vorliegt.
| Berufsgruppe | Rechtsgrundlage § 2 SGB VI | Rentenversicherungspflicht |
|---|---|---|
| Lehrer / Dozenten | Nr. 1 | Pflichtig |
| Pflegepersonen, Hebammen | Nr. 2 | Pflichtig |
| Künstler / Publizisten | Nr. 5 (KSVG) | Pflichtig (über KSK) |
| Handwerker (zulassungspflichtig) | Nr. 8 | Pflichtig → Befreiung nach 18 Jahren möglich |
| Hausgewerbetreibende / Seelotsen / Pflegeberufe | Nr. 3 ff. | Pflichtig |
| Sonstige Selbstständige ohne Beschäftigte | Nr. 9 | Einzelfallprüfung DRV |
Bei mehreren Auftraggebern entfällt die Pflicht nur, wenn mind. ein Arbeitnehmer regelmäßig beschäftigt wird oder eine gesetzliche Befreiung vorliegt.
| Merkmal | Selbstständig | Abhängig beschäftigt |
|---|---|---|
| Weisungsgebundenheit | Nein | Ja |
| Eingliederung in fremde Organisation | Eigenverantwortlich | In Betrieb eingegliedert |
| Eigene Betriebsstätte / Werbung / Rechnungsstellung | Ja | Nein |
| Unternehmerisches Risiko | Ja | Nein |
| Anzahl Arbeitgeber | > 1 Auftraggeber | 1 Hauptauftraggeber |
Diese Kriterien dienen auch der DRV-Clearingstelle als Grundlage der Statusprüfung nach § 7a SGB IV.
- Befreiungstatbestand § 6 SGB VI: Innerhalb von 3 Monaten nach Beginn beantragen.
- Befreiung z. B. bei Mitgliedschaft in einem Versorgungswerk (z. B. Ärzte, Rechtsanwälte).
- Handwerker → Befreiung nach 18 Jahren Pflichtversicherung (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 SGB VI).
- Nachweis durch DRV-Bescheid oder Bestätigung des Versorgungswerks.
Ohne rechtzeitigen Antrag bleibt Versicherungspflicht bestehen. Befreiung wirkt nur ex nunc (nicht rückwirkend).
- 🔹 Statusfrage prüfen vor Tätigkeitsbeginn (§ 7a SGB IV / DRV-Clearingstelle).
- 🔹 Zahl der Beschäftigten nachweisen (mind. 1 Angestellter → keine Pflicht).
- 🔹 Verträge schriftlich fixieren → Selbstständigkeit klarstellen.
- 🔹 DRV-Befreiung oder Versorgungswerkbescheinigung vorhalten.
- 🔹 Beitragszahlung (18,6 %) nur auf tatsächliches Arbeitseinkommen.
| Kriterium | Ergebnis |
|---|---|
| Nur ein Auftraggeber, keine Beschäftigten | Rentenversicherungspflicht möglich |
| Mehrere Auftraggeber oder Arbeitnehmer > 450 € | Keine Pflicht |
| Versorgungswerk oder Befreiung § 6 SGB VI | Befreit |
| Unklarheit über Status | DRV-Statusfeststellung empfohlen |
Praxis: Status vor Beginn prüfen → Risikovermeidung durch Früh-Klärung mit DRV. Bei falscher Einstufung drohen Nachzahlungen + Säumniszuschläge.
REVERSE-CHARGE-VERFAHREN
WIKI: REVERSE-CHARGE-VERFAHREN
Wenn die Steuerschuld umgedreht wird – besonders wichtig bei Google Ads, Meta, SaaS & Co.
Kurzfazit
- Reverse-Charge = Schuldner der Umsatzsteuer ist nicht der Leistungserbringer, sondern der Empfänger.
- Typisch bei Leistungen aus dem Ausland (z. B. Software, Werbung, Beratungen).
- Risiko: falsche Buchung → Vorsteuer weg, Nachzahlungen bei BP.
💡 Fast jeder Onlinehändler hat Reverse-Charge-Fälle – z. B. Facebook/Google Ads.
Wann gilt Reverse-Charge?
- Leistungserbringer im Ausland, Empfänger in Deutschland (Unternehmer).
- Typische Fälle: Online-Werbung, Cloud-/SaaS-Tools, Lizenzen, Beratungen.
- In Rechnung meist: „VAT 0 %, Reverse-Charge“.
- Empfänger muss USt in DE anmelden – gleichzeitig Vorsteuer (wenn abzugsberechtigt).
Praxis-Beispiele
Google Ads
Google Ireland Ltd. → Rechnung ohne USt. Händler in DE muss 19 % USt anmelden (Reverse-Charge).
Meta / Facebook Ads
Rechnung von Meta Ireland → ebenfalls ohne USt. Händler meldet und zieht 19 % in der USt-VA.
SaaS-Tools
Rechnung von US- oder EU-Anbieter (z. B. Shopify, Canva). Reverse-Charge gilt, wenn USt-IdNr. hinterlegt ist.
Buchhalterische Behandlung
- Umsatzsteuer wird fiktiv berechnet und in der USt-VA erklärt (z. B. Kennziffer 46/47).
- Vorsteuerabzug im gleichen Betrag (wenn berechtigt).
- Effekt: meist steuerneutral, aber Pflicht zur Meldung.
- Gefahr: Wird nicht gemeldet, erkennt das FA später → Nachzahlung ohne Vorsteuer.
Checkliste: So gehst du vor
👉 Wer diese Punkte beachtet, vermeidet die häufigsten BP-Nachforderungen.
Typische Fehler
- Rechnungen ignoriert („da keine Steuer draufsteht“).
- USt nicht erklärt → FA fordert später + Zinsen, Vorsteuerabzug oft gestrichen.
- Falsche Kontierung (Aufwand ohne USt-Korrektur).
- Keine USt-IdNr. hinterlegt → Dienstleister berechnet ausländische Steuer (nicht abziehbar).
FAQ zum Reverse-Charge-Verfahren
Gilt Reverse-Charge nur für Dienstleistungen?
Meist ja – besonders für grenzüberschreitende Dienstleistungen. Bei Warenlieferungen nur in Sonderfällen.
Was, wenn der Anbieter trotzdem USt berechnet?
Umsatzsteuer aus Irland/USA ist nicht als Vorsteuer abziehbar. Korrektur der Rechnung anfordern.
Wo trage ich das in der USt-VA ein?
Kennziffer 46 (Leistungen aus EU) / Kennziffer 47 (Leistungen aus Drittland).
Reverse-Charge-Verfahren einfach erklärt
Reverse-Charge-Verfahren
Beim Reverse Charge schuldet nicht der Leistende, sondern der
Leistungsempfänger die Umsatzsteuer.
Dieses Verfahren verlagert die Steuerschuld und wird in bestimmten Fällen vorgeschrieben.
- Typisch bei Auslandsgeschäften (innerhalb der EU oder bei Leistungen von ausländischen Unternehmen)
- Rechnung ohne Umsatzsteuer, stattdessen Pflichtangabe:
„Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (§ 13b UStG)“ - In der USt-Voranmeldung muss der Empfänger
den Umsatz und die entsprechende Vorsteuer angeben
Praxisbeispiel: Bauleistungen
Ein Subunternehmer erbringt Bauleistungen an ein anderes Bauunternehmen
(z. B. Trockenbauarbeiten). Nach § 13b UStG gilt hier das Reverse-Charge-Verfahren:
- Der Subunternehmer stellt eine Rechnung ohne Umsatzsteuer aus,
mit dem Hinweis auf die Steuerschuld des Leistungsempfängers. - Das beauftragende Bauunternehmen muss die Umsatzsteuer in seiner
USt-Voranmeldung deklarieren. - Gleichzeitig kann es die Steuer als Vorsteuer geltend machen
(soweit zum Vorsteuerabzug berechtigt).
Tipp: Verwende in deinem Rechnungsprogramm
Textbausteine für Reverse-Charge-Fälle, damit der korrekte Hinweis automatisch erscheint.
Schenkungsteuer
Schenkungsteuer – das Wichtigste
Die Schenkungsteuer folgt den gleichen Regeln wie die Erbschaftsteuer.
Sie wird fällig, wenn Vermögen unentgeltlich zu Lebzeiten übertragen wird.
Besondere Chancen bietet die Nutzung der Freibeträge alle 10 Jahre.
1) Freibeträge
- Die Freibeträge sind identisch zur Erbschaftsteuer.
- Ehegatte/Lebenspartner: 500.000 €
- Kinder: 400.000 € pro Elternteil
- Enkel: 200.000 € (wenn Elternteil verstorben)
- Übrige Personen: 20.000 €
- 👉 Alle 10 Jahre können Freibeträge erneut genutzt werden.
2) Steuersätze
Wie bei der Erbschaftsteuer: abhängig von Steuerklasse & Wert der Schenkung.
- Klasse I: Ehegatten, Kinder → 7 % bis 30 %
- Klasse II: Geschwister, Nichten, Neffen → 15 % bis 43 %
- Klasse III: übrige Personen → 30 % bis 50 %
3) Gestaltungsmöglichkeiten
- Freibeträge mehrfach nutzen: Vermögen in Abständen (10-Jahres-Regel) übertragen.
- Nießbrauch / Wohnrecht: mindern den steuerlichen Wert der Schenkung.
- Immobilien: Schenkung an Kinder oft steuerfrei möglich, wenn Eltern wohnen bleiben.
- Schenkungen unter Ehegatten: hoher Freibetrag + Steuerklasse I → steuerlich begünstigt.
4) Abgrenzung zur Erbschaftsteuer
- Schenkung: zu Lebzeiten → Freibeträge können mehrfach (alle 10 Jahre) genutzt werden.
- Erbschaft: einmaliger Vorgang beim Tod → Freibeträge nur einmal.
- 👉 Kombination von Schenkungen + Erbschaft oft steuerlich optimal.
5) Tipps für die Praxis
- Frühzeitig planen – gerade bei größeren Immobilien- oder Unternehmenswerten.
- Steuerfreie Übertragung von Familienheimen unter Bedingungen möglich.
- Dokumentation & notarielle Verträge sind zwingend.
- Individuelle Beratung ratsam – jede Schenkung ist anders.
SO ORGANISIERST DU DEINE BUCHHALTUNG DIGITAL
WIKI: SO ORGANISIERST DU DEINE BUCHHALTUNG DIGITAL
Von der Belegablage bis zum Steuerberater – digitale Buchhaltung spart Zeit, Nerven & Geld.
Kurzfazit: Warum digital?
- Weniger Papierkram, alles revisionssicher gespeichert.
- Zeit sparen durch Automatisierung (Bankimport, OCR, Schnittstellen).
- Besserer Überblick: Liquidität, offene Rechnungen, Steuerlast.
- Ortsunabhängig arbeiten – Kanzlei und Unternehmer sehen dasselbe.
Digitale Buchhaltung ist nicht nur „Scan statt Ordner“ – sondern ein kompletter Workflow.
Die Grundbausteine der digitalen Buchhaltung
- Belegerfassung: Scannen oder App-Foto → automatisches Auslesen.
- Bankkonten/PayPal: direkte Schnittstelle → automatische Zuordnung.
- Rechnungsausgang: Rechnungssoftware mit USt-Check & Schnittstelle.
- Cloud-Ablage: GoBD-konform, revisionssicher, mit Zugriffsrechten.
- Schnittstelle Steuerberater: DATEV- oder API-Export.
Tools & Software – was du brauchst
Belegmanagement
- Apps wie GetMyInvoices, sevDesk, lexoffice.
- Automatische Belegerkennung (OCR).
- Digitale Freigabe-Workflows für Team.
Bank & Kasse
- Bankkonten anbinden (API/Schnittstelle).
- Automatische Verbuchung von Zahlungseingängen.
- Kassenführung digital – GoBD-konform.
Rechnungswesen
- Rechnungstools mit Steuerlogik (USt, RC, OSS).
- Wiederkehrende Rechnungen automatisieren.
- Schnittstellen zu Steuerberater & Reporting.
Praxis-Checkliste für deine digitale Buchhaltung
Tipp: Einmal sauber aufsetzen, danach läuft die Buchhaltung (fast) automatisch.
Typische Fehler vermeiden
- Scans als PDF-Sammlungen → nicht durchsuchbar, nicht GoBD-sicher.
- Doppelte Ablage: in Cloud + Ordner → Chaos & Versionsprobleme.
- Keine Zugriffsrechte → Mitarbeiter haben „alles oder nichts“.
- Steuerberater nicht eingebunden → unnötiger Mehraufwand.
FAQ: häufige Fragen zur digitalen Buchhaltung
Ist ein Papierarchiv trotzdem nötig?
Nein – wenn die Ablage GoBD-konform ist, reicht die digitale Form. Original-Papier muss nicht zusätzlich aufbewahrt werden.
Kann ich mit Excel arbeiten?
Excel allein ist nicht GoBD-konform (änderbar, kein Prüfprotokoll). Nutze zertifizierte Software.
Welche Schnittstelle ist Standard?
In Deutschland: DATEV. Viele Tools bieten aber auch API-Exporte an.
Sonderausgaben
|
ℹ️
Wichtiger Hinweis:
Dieses Wiki dient der allgemeinen Orientierung. Es ersetzt keine individuelle steuerliche Beratung. Für eine persönliche Einschätzung sprich uns jederzeit direkt an. WIKI: Sonderausgaben & SpendenErfahre schnell, welche Ausgaben du als Sonderausgaben absetzen kannst – und wie Spenden deine Steuerlast senken.
Steuertipp:
Sammle Belege fürs ganze Jahr in einem Ordner oder digital (z. B. „Sonderausgaben & Spenden“),
damit zur Steuererklärung nichts verloren geht.
Wichtige Beispiele (Auszug):
Achtung:
Beiträge und Verträge sind in der Regel nur dann absetzbar, wenn du selbst Versicherungsnehmer:in bist
und die Zahlungen tatsächlich getragen hast.
Abzugsfähige Spenden sind z. B.:
Wichtig ist, dass die Organisation in Deutschland (oder EU/EWR) steuerbegünstigt ist und dir eine Zuwendungsbestätigung ausstellen darf. 🧮 Mini-Rechner: Grobe Steuerersparnis durch Spenden
Geschätzte Steuerersparnis: 0 €
(vereinfachte Beispielrechnung – ohne Prüfung von Höchstbeträgen)
Steuertipp:
Größere Spenden lieber per Überweisung leisten und den Verwendungszweck klar bezeichnen
(z. B. „Spende <Name Organisation>“).
Besonderheit: Spenden und Mitgliedsbeiträge an politische Parteien und bestimmte Wählervereinigungen werden steuerlich anders behandelt als „normale“ Spenden.
Achtung:
Hier gelten besondere Höchstbeträge und Unterscheidungen (z. B. Alleinstehend / verheiratet).
Für konkrete Beträge sprich uns am besten direkt an.
Damit Spenden anerkannt werden, brauchst du in der Regel:
Bewahre Spendenbescheinigungen mindestens so lange auf,
wie das Finanzamt deine Steuererklärung noch prüfen kann.
Achtung:
Wenn du im Zweifel bist, ob eine Zahlung wirklich als Spende gilt, frag lieber vorab nach –
im Nachhinein lässt sich das oft nicht mehr retten.
Wenn du uns deine Unterlagen digital überlässt, benenne Dateien möglichst eindeutig
(z. B. „2025_Spende_DRK_200EUR.pdf“).
📞
Noch Fragen zu Sonderausgaben oder Spenden?
Wir prüfen gern, welche Beträge bei dir konkret wirken und wie du deine Steuer optimal nutzt. |
Sonderausgaben & außergewöhnliche Belastungen
Sonderausgaben & außergewöhnliche Belastungen
Neben Werbungskosten können Steuerpflichtige auch Sonderausgaben und
außergewöhnliche Belastungen geltend machen.
Beide mindern die Steuerlast, unterscheiden sich aber in den Voraussetzungen.
1. Sonderausgaben
- Vorsorgeaufwendungen: Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung.
- Altersvorsorge: z. B. Rürup-Rente (Basisrente), Riester-Verträge.
- Spenden & Mitgliedsbeiträge: an gemeinnützige Organisationen (Spendenquittung notwendig).
- Kirchensteuer: gezahlte Beträge sind voll abzugsfähig.
- Unterhaltsleistungen: an bedürftige Personen, wenn gesetzlich geschuldet.
2. Außergewöhnliche Belastungen
- Krankheitskosten: Arzt, Medikamente, Heilmittel, Hilfsmittel (nach Nachweis durch Atteste/Rechnungen).
- Pflegekosten: für Angehörige oder bei eigener Pflegebedürftigkeit.
- Bestattungskosten: soweit sie nicht aus dem Nachlass oder durch Versicherungen gedeckt sind.
- Scheidungskosten: nur eingeschränkt (zwingende Prozesskosten).
3. Zumutbare Eigenbelastung
- Außergewöhnliche Belastungen werden nur berücksichtigt, wenn sie die
zumutbare Eigenbelastung übersteigen. - Diese richtet sich nach Einkommen, Familienstand und Kinderzahl.
- Je höher das Einkommen, desto höher auch die Eigenbelastung.
4. Tipps für die Praxis
- Belege gut aufbewahren (Rechnungen, Zahlungsnachweise, ärztliche Atteste).
- Spendenquittungen müssen bestimmte Formvorgaben erfüllen.
- Hohe außergewöhnliche Belastungen → ggf. außerordentliche Steuererleichterung beantragen.
- Steuerberater einbeziehen, wenn größere Beträge im Raum stehen.
Sonderausgaben & Belastungen – schnelle Orientierung
- Sonderausgaben: Vorsorge, Altersvorsorge, Spenden, Kirchensteuer
- Außergewöhnliche Belastungen: Krankheits-, Pflege- und Bestattungskosten
- Zumutbare Eigenbelastung: muss überschritten werden
Hinweis: Diese Übersicht ersetzt keine individuelle Steuerberatung.
Gerade bei außergewöhnlichen Belastungen ist eine Einzelfallprüfung nötig.
Steuerfallen bei Immobilien
Steuerfallen bei Immobilien
Ob privat oder im Betriebsvermögen: Immobilien bergen steuerliche Tücken. Wer sie kennt, spart viel Geld und Ärger.
Typische Steuerfallen
Praxis-Beispiele
- Fall 1: Eigentümer verkauft nach 8 Jahren eine vermietete Wohnung → voller Gewinn steuerpflichtig.
- Fall 2: Investor kauft mehrere Wohnungen und verkauft nach kurzer Zeit mehr als 3 → gewerblicher Grundstückshandel.
- Fall 3: Unternehmer vermietet eigene Halle an GmbH → Betriebsaufspaltung, Immobilie im Betriebsvermögen.
Checkliste: Vor Immobilienverkauf prüfen
- Liegt die 10-Jahres-Spekulationsfrist bereits hinter mir?
- Habe ich die Immobilie zwischendurch selbst genutzt (mindestens im Jahr des Verkaufs + 2 vorherige Jahre)?
- Gibt es anschaffungsnahe Herstellungskosten in den ersten 3 Jahren, die steuerlich relevant sind?
- Wird durch den Verkauf evtl. ein gewerblicher Grundstückshandel ausgelöst (3-Objekt-Grenze)?
- Handelt es sich um Betriebsvermögen (z. B. wegen Vermietung an eigenes Unternehmen)?
- Sind mögliche Verlustvorträge nutzbar oder gehen sie verloren?
- Wie wirkt sich der Verkauf auf Erbschaft- oder Schenkungssteuer in der Familie aus?
- Sollte die Immobilie besser in eine Gesellschaft (z. B. GmbH oder Holding) eingebracht werden?
Steuerfreie Arbeitgeberleistungen
Steuerfreie Arbeitgeberleistungen
Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern zahlreiche Leistungen steuerfrei oder pauschalbesteuert gewähren.
Richtig genutzt sind diese Benefits attraktiv für beide Seiten – Mitarbeiter profitieren direkt, Arbeitgeber sparen Lohnnebenkosten.
1. Inflationsausgleichsprämie
- Bis zu 3.000 € steuer- und sozialversicherungsfrei möglich (Zeitraum bis 31.12.2024).
- Freiwillige Zusatzleistung des Arbeitgebers.
- Kann in Teilbeträgen ausgezahlt werden.
2. Sachbezüge & Gutscheine
- 50 € monatlich steuer- und sozialversicherungsfrei (z. B. Tankgutscheine, Gutscheinkarten).
- Wichtig: Es muss sich um einen echten Sachbezug handeln, keine Barauszahlung.
- Beliebt: Essensgutscheine, Shopping- oder Tankkarten.
3. Gesundheit & Mobilität
- Jobticket: Zuschüsse oder kostenlose ÖPNV-Tickets sind steuerfrei.
- Dienstfahrrad / E-Bike: Überlassung steuerfrei oder pauschal begünstigt.
- Gesundheitsförderung: bis zu 600 € pro Jahr steuerfrei für zertifizierte Maßnahmen.
4. Weitere steuerfreie Leistungen
- Kita-Zuschüsse: Steuerfrei, wenn zweckgebunden für Kinderbetreuung.
- Fort- und Weiterbildungskosten: uneingeschränkt steuerfrei.
- Umzugskosten: bei beruflich veranlasstem Umzug erstattungsfähig.
- Aufmerksamkeiten: kleine Geschenke bis 60 € zu besonderen Anlässen steuerfrei.
5. Tipps für Arbeitgeber
- Steuerfreie Benefits sind für Arbeitnehmer oft wertvoller als Gehaltserhöhungen.
- Leistungen klar dokumentieren, um Diskussionen mit dem Finanzamt zu vermeiden.
- Kombination mehrerer steuerfreier Leistungen möglich (z. B. Jobticket + 50 €-Sachbezug).
Steuerfreie Arbeitgeberleistungen – schnelle Orientierung
- Inflationsprämie: bis 3.000 € (bis Ende 2024)
- Sachbezüge: bis 50 € / Monat
- Jobticket, Dienstfahrrad, Gesundheit: steuerfrei nutzbar
- Kita-Zuschuss & Weiterbildung: unbegrenzt möglich
Hinweis: Diese Übersicht ersetzt keine individuelle Beratung.
Steuerfreie Benefits müssen richtig gestaltet werden, um wirksam zu sein.
STEUERFREIE ARBEITGEBERLEISTUNGEN
WIKI: STEUERFREIE ARBEITGEBERLEISTUNGEN
Welche Benefits sind lohnsteuer- & sozialversicherungsfrei – und was ist zu beachten?
Kurzfazit
- Viele Leistungen sind steuer- und beitragsfrei – wenn die Formalien stimmen (z. B. „zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“).
- Beliebte Klassiker: 50-€-Sachbezug, Jobticket, Gesundheitsförderung, Kindergarten, Dienstrad, Laden von E-Autos.
💡 Tipp: Benefits in einer Benefit-Policy bündeln und monatlich dokumentieren.
Top-Leistungen & Grenzen (Auswahl)
| Leistung | Steuerstatus | Voraussetzungen / Grenzen |
|---|---|---|
| Sachbezug (Gutscheine/Karten) | steuer- & SV-frei | 50 € mtl. Freigrenze; nur echte Sachbezüge gem. ZAG (keine Bar-/Überweisungen); zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Lohn. |
| Jobticket | steuer- & SV-frei | Für ÖPNV/DB (Arbeitsweg & privat); zusätzlich zum Lohn; Nachweis/Belege erforderlich. |
| Gesundheitsförderung | steuer- & SV-frei | bis 600 € p. a.; nur zertifizierte Maßnahmen (§ 20 SGB V); Nachweis aufbewahren. |
| Kindergarten-/Kita-Zuschuss | steuer- & SV-frei | Zusätzlich zum Lohn; nur für nicht schulpflichtige Kinder; Rechnung auf Namen der Eltern. |
| Dienstrad (Fahrrad/E-Bike ohne Kennzeichen) | steuer- & SV-frei | Überlassung zusätzlich zum Lohn; Privatnutzung steuerfrei (befristete Begünstigung); Leasing gängig. |
| Laden von E-Autos im Betrieb | steuer- & SV-frei | Unentgeltliches/verbilligtes Laden beim Arbeitgeber begünstigt (befristete Regelung); Doku empfohlen. |
| Bildungsleistungen | meist steuerfrei | Wenn überwiegend betriebliches Interesse (Fortbildungen); Kostenübernahme/-erstattung statt Barlohn. |
⚠️ „Zusätzlichkeitskriterium“ streng beachten: Umwandlung von Barlohn → keine Steuerfreiheit.
Beispielrechnung: Fitnessstudio-Zuschuss
Der Arbeitgeber möchte einen Fitnessstudio-Beitrag von 60 € monatlich übernehmen. Die steuerfreie Grenze für Sachbezüge liegt jedoch bei 50 €.
| Variante | AG-Zuschuss | Steuerstatus | AN-Belastung |
|---|---|---|---|
| Korrekt | 50 € | steuer- & SV-frei | 10 € zahlt der Arbeitnehmer selbst ans Studio |
| Fehlerhaft | 60 € | Gesamter Betrag steuer- & beitragspflichtig (Grenze überschritten) | – |
💡 Wichtig: Freigrenze = wird sie überschritten, ist der gesamte Betrag steuerpflichtig – nicht nur der übersteigende Teil.
Checkliste: So setzt du Benefits korrekt um
FAQ
Gilt die 50-€-Grenze pro Mitarbeiter oder pro Gutschein?
Pro Mitarbeiter und Monat insgesamt – mehrere Gutscheine addieren sich.
Sind Barzuschüsse begünstigt?
Nein. Barlohn/Überweisungen sind nicht steuerfrei. Nur echte Sachbezüge/Gutscheine i. S. d. ZAG.
Darf ich Benefits auch variabel gewähren?
Ja, aber Grenzwerte im Blick behalten; besser per Policy regeln.
Steuerklassen im Überblick
Steuerklassen im Überblick
Die Lohnsteuerklasse beeinflusst nur die monatliche Nettoauszahlung (Lohnsteuerabzug),
nicht die endgültige Jahressteuer. Für Verheiratete/Lebenspartner gibt es Wahlmöglichkeiten,
die das Netto verteilen (Kombinationen III/V, IV/IV, IV mit Faktor). Singles und Alleinerziehende nutzen
eigene Klassen (I, II). Nebenjobs laufen i. d. R. über Klasse VI.
Auf einen Blick
I Singles • II Alleinerziehende
III/V oder IV/IV • IV mit Faktor
Klasse VI für den Zweit-/Nebenjob
1. Die Steuerklassen
- Klasse I: Ledige, Geschiedene, Verwitwete; Standard für Singles.
- Klasse II: Alleinerziehende mit Entlastungsbetrag (Voraussetzungen beachten).
- Klasse III: Verheiratete/Lebenspartner, wenn der/die andere Klasse V wählt (höheres Netto bei deutlichem Einkommensunterschied).
- Klasse IV: Verheiratete/Lebenspartner – beide ähnlich hohes Einkommen (ausgeglichene Verteilung).
- Klasse V: „Gegenstück“ zu III; geringeres Netto (mehr Abzug), sinnvoll bei stark ungleichem Einkommen.
- Klasse VI: Zweit- oder Nebenjob (nicht Minijob) – höchste Abzüge, da keine Freibeträge berücksichtigt werden.
2. Kombinationen für Verheiratete/Lebenspartner
- IV/IV: ähnlich hohe Bruttos → faire Nettoteilung, wenig Nachzahlungen wahrscheinlich.
- III/V: deutlich ungleiche Bruttos → mehr Netto beim höheren Einkommen (III), aber Risiko von Nachzahlungen am Jahresende.
- IV/IV mit Faktor: genauer, verteilt Freibeträge nach Verhältnis (Progression eingerechnet) → meist geringere Nachzahlungen.
Tipp: Bei Lohnersatzleistungen (z. B. Elterngeld) kann eine frühzeitige Wahl von III/IV-Faktor das Netto des relevanten Elternteils erhöhen –
aber immer den Gesamtfall prüfen.
3. Wechsel & Freibeträge
- Wechsel der Steuerklasse: bei Eheschließung, Trennung, Einkommensänderung etc. mehrfach pro Jahr möglich (Antrag beim Finanzamt/ELStAM).
- Freibeträge (ELStAM): z. B. Werbungskosten-Pauschale erhöht? Kinderfreibeträge, Pendlerpauschale, Unterhalt – können als jährlicher Freibetrag eingetragen werden.
- Nebenjob: Minijob bis 520 € meist pauschal versteuert (ohne Einfluss auf die Steuerklasse). Ein weiterer regulärer Job → Klasse VI.
4. Lohnersatzleistungen & Progressionsvorbehalt
- Elterngeld, Krankengeld, Kurzarbeitergeld u. a. sind steuerfrei, unterliegen aber dem Progressionsvorbehalt → können die Jahressteuer erhöhen.
- Steuerklasse beeinflusst die Höhe der laufenden Nettoauszahlung, nicht automatisch die endgültige Steuerlast.
- Bei längeren Ersatzleistungen lohnt oft die Simulation (z. B. IV-Faktor vs. III/V).
5. Praxis-Checkliste
- Einkommen ähnlich? → IV/IV oder IV mit Faktor.
- Einkommen sehr unterschiedlich? → III/V, aber Nachzahlungsrisiko beachten.
- Geplantes Elterngeld/Krankengeld? → Netto des relevanten Elternteils frühzeitig optimieren (Fristen beachten).
- Zweitjob? → meist VI (Minijob getrennt betrachten).
- Freibetrag eintragen, wenn hohe Werbungskosten/Belastungen anstehen → mehr monatliches Netto, ggf. weniger Erstattung.
Hinweis: Diese Übersicht ersetzt keine individuelle Beratung. Regeln und Werte können sich ändern; Details in Tarif-/Arbeitsvertrag und aktuellen
Verwaltungsanweisungen beachten.
Steuerklassen – schnelle Orientierung
- I: Single
- II: Alleinerziehend (mit Entlastungsbetrag)
- IV/IV: Einkommen ähnlich hoch
- IV/IV mit Faktor: sehr ähnlich → weniger Nachzahlungen
- III/V: deutlicher Unterschied (⚠️ bei Elterngeld Klasse V prüfen)
- VI: Zweit-/Nebenjob (kein Minijob)
Hinweis: Dies ist nur eine Orientierung – individuelle Faktoren (Kirchensteuer, Freibeträge, Abzüge, Ersatzleistungen) können das Ergebnis ändern.
Steuerliche Nebenleistungen
Steuerliche Nebenleistungen – was ist das eigentlich?
Neben den eigentlichen Steuern (z. B. Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer) kennt die Abgabenordnung eine ganze Reihe von steuerlichen Nebenleistungen. Dazu gehören unter anderem Verspätungszuschläge, Säumniszuschläge, Zinsen, Schätzungen und Verzögerungsgelder. Auf dieser Seite erklären wir die wichtigsten Punkte – verständlich, praxisnah und mit klaren Empfehlungen.
Was sind steuerliche Nebenleistungen?
Steuerliche Nebenleistungen sind Zahlungen, die zusätzlich zur eigentlichen Steuer anfallen können. Ziel ist oft, rechtzeitige Abgabe von Erklärungen, pünktige Zahlungen und Mitwirkung im Verfahren sicherzustellen.
- ✔ Sie fallen an, wenn Fristen nicht eingehalten, Steuern nicht gezahlt oder Mitwirkungspflichten verletzt werden.
- ✔ Sie sind keine „Strafe“ im strafrechtlichen Sinn, können aber finanziell deutlich weh tun.
- ✔ Viele Nebenleistungen lassen sich durch gute Organisation und frühzeitigen Kontakt mit uns vermeiden.
Warum das Thema so wichtig geworden ist
Durch Digitalisierung, strengere Fristen und automatisierte Abläufe fällt die Finanzverwaltung steuerliche Nebenleistungen heute deutlich konsequenter an als früher.
- ⚡Verspätungszuschläge werden bei verspäteter Abgabe zunehmend automatisch festgesetzt.
- ⚡Säumniszuschläge entstehen bei verspäteter Zahlung – oft ohne Ermessensspielraum.
- ⚡Schätzungen und Verzögerungsgelder nach § 162 AO haben an Bedeutung gewonnen, insbesondere bei digitalen Daten.
📊 Die wichtigsten steuerlichen Nebenleistungen im Überblick
Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Nebenleistungen, die in der Praxis immer wieder vorkommen.
| Nebenleistung | Worum geht es? | Typische Auslöser | Praxis-Hinweis |
|---|---|---|---|
| Verspätungszuschlag § 152 AO |
Zuschlag, wenn Steuererklärungen nicht fristgerecht abgegeben werden. | Einkommensteuer-, Umsatzsteuer-, Körperschaftsteuer- oder Gewerbesteuererklärung wird deutlich verspätet abgegeben. |
Automatisierungsrisiko Häufig automatisiert festgesetzt. Eine Reduzierung ist nur mit guter Begründung und im Einzelfall möglich. |
| Säumniszuschlag § 240 AO |
Zuschlag für verspätete Zahlung fälliger Steuern. | Steuerbescheid wird nicht rechtzeitig bezahlt, abgeschlossene Ratenzahlung wird nicht eingehalten. |
Lastschrift empfehlenswert Am besten SEPA-Lastschrift einrichten – dann werden Steuern automatisch eingezogen. |
| Nachzahlungs-/Erstattungszinsen §§ 233a, 238 AO |
Zinsen auf Steuernachforderungen oder -erstattungen für zurückliegende Jahre. | Größere Abweichungen zwischen Vorauszahlungen und tatsächlicher Jahressteuer, späte Veranlagung. |
Zinsrisiko im Blick Durch vorausschauende Vorauszahlungen und rechtzeitige Erklärungen steuerbar. |
| Schätzung der Besteuerungsgrundlagen § 162 Abs. 1–3 AO |
Finanzamt setzt Einnahmen/Gewinne geschätzt fest, wenn Unterlagen fehlen oder unplausibel sind. | Fehlende Buchführung, formell nicht ordnungsgemäße Kassenführung, nicht beantwortete Rückfragen. |
Oft sehr teuer Schätzungen fallen in der Regel nicht „zugunsten“ des Steuerpflichtigen aus. |
| Verzögerungsgeld § 146 Abs. 2b i.V.m. § 162 Abs. 4 AO |
Geldbetrag für nicht oder verspätet vorgelegte Unterlagen / Daten. | Anforderung von Aufzeichnungen, digitalen Daten oder Dokumentationen wird ignoriert oder verschleppt. |
Spannweite 2.500–250.000 € Schon die Untergrenze kann spürbar sein – bitte Fristen ernst nehmen. |
| Zwangsgeld / Zwangshaft §§ 328 ff. AO |
Durchsetzung von Mitwirkungspflichten, z. B. Abgabe von Erklärungen oder Herausgabe von Unterlagen. | Hartnäckige Weigerung, Pflichten zu erfüllen, trotz mehrfacher Aufforderung. |
Eskalationsstufe Tritt meist erst auf, wenn vorherige Aufforderungen ignoriert wurden. |
| Vollstreckungskosten §§ 249 ff. AO |
Gebühren und Auslagen im Rahmen der Beitreibung (z. B. Pfändung). | Längere Nichtzahlung, Inkasso durch Vollstreckungsstelle, Kontopfändungen. |
Vermeidbar Frühzeitig mit uns sprechen – oft sind Ratenzahlungen oder Stundungen möglich. |
📑 Schätzung & Verzögerungsgeld nach § 162 AO (Absätze 3 und 4)
§ 162 AO regelt, wann das Finanzamt die Besteuerungsgrundlagen schätzen darf. Besonders praxisrelevant sind heute die Absätze 3 und 4 – sie betreffen Mitwirkungspflichten und digitale Daten.
Schätzung bei fehlender Mitwirkung
Wenn gesetzliche Aufzeichnungs- oder Mitwirkungspflichten nicht erfüllt werden, darf das Finanzamt die Besteuerungsgrundlagen schätzen. In der Praxis heißt das:
- • unvollständige oder fehlende Buchführung
- • mangelhafte oder manipulationsanfällige Kassenführung
- • angeforderte Unterlagen werden nicht oder nur teilweise vorgelegt
- • elektronische Daten (z. B. Kassen- oder Buchführungsdaten) stehen nicht zur Verfügung
Verzögerungsgeld bei verweigerter Mitwirkung
Zusätzlich zur Schätzung kann ein Verzögerungsgeld festgesetzt werden, wenn der Steuerpflichtige seine Pflichten zur Vorlage von Unterlagen oder Daten nicht erfüllt.
Rahmen: mindestens 2.500 € bis maximal 250.000 €.
- • Aufforderung zur Vorlage von Buchführungs- oder Kassen-Rohdaten wird ignoriert
- • digitale Unterlagen werden bewusst zurückgehalten
- • Verrechnungspreis-Dokumentation wird trotz Fristsetzung nicht vorgelegt
- • mehrfache Fristverlängerungen, aber keine Lieferung von Unterlagen
💡 Wichtige Merksätze für Mandanten
- ➤Verspätungszuschläge entstehen, wenn Erklärungen verspätet abgegeben werden – hier können wir oft prüfen, ob Spielraum besteht.
- ➤Säumniszuschläge entstehen automatisch bei verspäteter Zahlung – hier hilft eine rechtzeitige Lastschrift oder Ratenvereinbarung.
- ➤Zinsen fallen bei Nachzahlungen und Erstattungen für zurückliegende Jahre an – je früher die Erklärung, desto besser steuerbar.
- ➤Schätzungen können zu deutlich höheren Steuerbeträgen führen als bei ordnungsgemäßer Mitwirkung.
- ➤Verzögerungsgelder sind vermeidbar, wenn Unterlagen fristgerecht eingereicht werden.
- ➤Vollstreckungskosten und Pfändungen sind meist die letzte Stufe – so weit muss es nicht kommen.
- ➤Je früher Sie uns einbinden, desto größer sind die Chancen, Nebenleistungen zu verhindern oder zu reduzieren.
🛡️ Wie Sie steuerliche Nebenleistungen vermeiden können
Mit ein paar einfachen Grundregeln lassen sich die meisten Nebenleistungen vermeiden oder zumindest deutlich verringern.
Organisation & Fristen
- ✅Steuerunterlagen rechtzeitig an die Kanzlei übergeben – idealerweise nicht „auf den letzten Drücker“.
- ✅Fristverlängerungsanträge laufen über uns – bitte kurzfristig Rücksprache halten.
- ✅SEPA-Lastschrift für wichtige Steuerarten einrichten, um Säumniszuschläge zu vermeiden.
- ✅Ratenzahlung oder Stundung frühzeitig ansprechen, statt Bescheide „einfach liegen zu lassen“.
Unterlagen & digitale Daten
- ✅Kassen- und Buchführungsdaten 10 Jahre vollständig und elektronisch verfügbar halten.
- ✅Post vom Finanzamt, insbesondere Betriebsprüfungsankündigungen und Aufforderungsschreiben, sofort weiterleiten.
- ✅Bei Auslandsbezug (Wohnsitz, Arbeit, Kapitalanlagen, Immobilien) frühzeitig informieren – hier entstehen schnell komplexe Sachverhalte.
- ✅Bei technischen Problemen (Kasse, Software) nicht warten, sondern mit uns Rücksprache halten.
🧮 Mini-Rechner: Säumniszuschlag (vereinfachte Orientierung)
Mit diesem Mini-Rechner können Sie überschlägig berechnen, wie hoch der Säumniszuschlag bei verspäteter Zahlung einer Steuer ausfallen kann. Grundlage ist die aktuelle Rechtslage: 1 % pro angefangenem Monat auf die auf volle 50 € abgerundete Steuerschuld.
Eingaben
Ergebnis
📈 Mini-Rechner: Zinsen nach § 233a AO (vereinfacht)
Mit diesem Mini-Rechner können Sie überschlägig die Höhe der Zinsen nach § 233a AO berechnen. Die Zinsen werden pro vollendetem Monat berechnet. Der monatliche Zinssatz kann angepasst werden (z. B. 0,15 % pro Monat).
Eingaben
Ergebnis
📬 Wann sollten Sie sich sofort bei uns melden?
Bitte melden Sie sich möglichst zeitnah bei uns, wenn Sie eines der folgenden Schreiben vom Finanzamt erhalten:
- 📌Mahnung, Androhung von Säumnis- oder Verspätungszuschlägen
- 📌Zinsbescheid oder geänderter Steuerbescheid mit Nachzahlung
- 📌Aufforderung zur Vorlage von Unterlagen, digitalen Daten oder Verrechnungspreis-Dokumentationen
- 📌Ankündigung einer Außenprüfung oder Nachschau (z. B. Umsatzsteuer-Nachschau)
- 📌Schreiben der Vollstreckungsstelle (z. B. Pfändungsankündigung)
- 📌Androhung oder Festsetzung eines Verzögerungsgeldes oder Zwangsgeldes
📄 Kontakt aufnehmen
Steuerpflicht im EStG
|
ℹ️
Wichtiger Hinweis:
Dieses Wiki dient der allgemeinen Orientierung. Es ersetzt keine individuelle steuerliche Beratung. Für eine persönliche Einschätzung sprich uns jederzeit direkt an. WIKI: Steuerpflicht in der EinkommensteuerWann bist du unbeschränkt oder beschränkt einkommensteuerpflichtig – und welche steuerlichen Folgen hat das? In Deutschland unterscheidet man zwei Arten der Einkommensteuerpflicht:
Das wichtigste Kriterium ist dein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland.
Du bist unbeschränkt steuerpflichtig, wenn mindestens einer der folgenden Punkte zutrifft:
Folgen:
Wer in Deutschland lebt, wird steuerlich fast immer voll erfasst – auch wenn ein Großteil der Einkünfte aus dem Ausland stammt.
Du bist beschränkt steuerpflichtig, wenn du keinen Wohnsitz und keinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hast, aber bestimmte deutsche Einkünfte erzielst. Typische Fälle:
Folgen:
Beschränkte Steuerpflicht ist oft steuerlich ungünstig, weil viele Vorteile wegfallen.
Wenn du im Ausland lebst, aber mind. 90% deiner Einkünfte in Deutschland versteuerst ODER deine ausländischen Einkünfte unter dem deutschen Grundfreibetrag liegen, kannst du dich auf Antrag wie unbeschränkt steuerpflichtig behandeln lassen. Vorteile:
Typische Fälle:
Für den Antrag benötigt das Finanzamt meist eine Bescheinigung der ausländischen Steuerbehörde über die Höhe der Auslandseinkünfte.
Wenn Einkünfte in mehreren Ländern erzielt werden, regeln Doppelbesteuerungsabkommen:
DBA-Regeln sind oft komplex – eine genaue Prüfung spart häufig viel Geld.
📞
Unsicher, wie du steuerlich eingestuft wirst?
Wir prüfen für dich genau, ob unbeschränkte oder beschränkte Steuerpflicht zutrifft – und welche Vorteile du optimal nutzen kannst. |
STREAMEN BEI TWITCH – STEUERN RICHTIG EINORDNEN
WIKI: STREAMEN BEI TWITCH – STEUERN RICHTIG EINORDNEN
Subs, Bits & Donations – wann Streaming vom Hobby zum steuerpflichtigen Business wird.
Kurzfazit
- Jede Einnahme über Twitch ist steuerpflichtig – auch „Donations“.
- Ab einer gewissen Höhe: Gewerbeanmeldung + Steuererklärungen Pflicht.
- Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG) kann USt-Pflichten vermeiden.
💡 Viele Streamer unterschätzen, dass auch kleine Beträge steuerlich zählen.
Welche Einnahmen sind betroffen?
- Abonnements (Subs) – monatliche Beiträge der Zuschauer.
- Bits & Cheer – digitale „Trinkgelder“.
- Donations über PayPal oder andere Tools (steuerlich keine Spenden!).
- Werbung und Affiliate-Programme über Twitch.
Einkommensteuer & Gewerbesteuer
- Alle Einnahmen gelten als gewerbliche Einkünfte.
- Einkommensteuer: ab dem Grundfreibetrag (~11.600 € in 2025).
- Gewerbesteuer: erst ab Gewinn über 24.500 €/Jahr.
- Absetzbar: PC, Kamera, Mikro, Software, Internet, Raumkosten anteilig.
Umsatzsteuer bei Twitch
- Twitch sitzt in Luxemburg und wickelt die Umsatzsteuer für Zuschauerumsätze ab (Subs, Bits, Werbung).
- 👉 Für Streamer: Twitch zahlt Netto-Auszahlungen aus – diese sind steuerpflichtige Betriebseinnahmen.
- Reverse-Charge: Auf die Twitch-Gebühren musst du als Unternehmer deutsche USt anmelden (Kennziffer 46 in USt-VA) und kannst sie gleichzeitig als Vorsteuer ziehen.
- Kleinunternehmerregelung: Bis 2024 Grenze 22.000 €/50.000 €, ab 2025 erhöht auf 25.000 € / 100.000 €. Dann entfällt die USt-Pflicht komplett.
⚠️ Donations über PayPal sind ebenfalls umsatzsteuerpflichtige Umsätze (kein Spendenprivileg).
Praxis-Beispiele
Student, 200 €/Monat
Bleibt meist Kleinunternehmer. Keine USt, aber Einkommensteuer, wenn Grundfreibetrag überschritten.
Streamer, 1.500 €/Monat
Überschreitet Grenze → Gewerbe + Regelbesteuerung. Reverse-Charge für Gebühren beachten.
Vollzeit-Streamer, 5.000 €/Monat
ESt, GewSt & USt alle relevant. Buchhaltung digital organisieren dringend empfohlen.
Checkliste für Streamer
FAQ: Häufige Fragen
Muss ich auch als kleiner Streamer Steuern zahlen?
Ja – steuerpflichtig sind alle Einnahmen. Ob du tatsächlich Steuern zahlst, hängt von Höhe & Freibeträgen ab.
Sind Donations steuerfrei?
Nein – sie gelten als umsatz- und einkommensteuerpflichtige Einnahmen.
Muss ich Rechnungen schreiben?
Ja – sobald du als Unternehmer auftrittst, solltest du Rechnungen für Kooperationen/Sponsoren erstellen.
Welche Kosten kann ich als Streamer absetzen?
- Hardware: PC, Kamera, Mikrofon, Headset, Beleuchtung.
- Software & Tools: Streaming-Software, Schnittprogramme, Cloud-Dienste, Lizenzgebühren.
- Spiele & In-Game-Käufe: wenn sie betriebsnotwendig für den Stream sind.
- Internet & Strom: anteilig für den betrieblichen Anteil.
- Arbeitszimmer: anteilig, wenn klar abgrenzbar.
- Reisekosten: z. B. Messen, Events, Community-Treffen.
- Werbung & Marketing: Grafiken, Designer, Social Ads.
⚠️ Wichtig: Kosten müssen betriebsnotwendig sein und mit dem Stream in direktem Zusammenhang stehen. Private Nutzung → nur anteiliger Abzug.
Überstundenzuschläge
💼 Überstundenzuschläge – Steuerliche & SV-rechtliche Behandlung
Kanzlei-Wiki • Stand: Oktober 2025
Überstundenzuschläge sind zusätzliche Zahlungen für Arbeit über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus.
Die steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Behandlung hängt von der Art und Zeit der Arbeitsleistung ab.
Überstundenzuschläge können steuerfrei sein, wenn sie:
- für tatsächlich geleistete Arbeit gezahlt werden,
- zusätzlich zum Grundlohn gezahlt werden (nicht umgewandelt),
- und die gesetzlichen Höchstgrenzen nicht überschreiten.
| Art der Arbeit | Max. steuerfreier Zuschlag | Steuerfreie Grundlage | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Nachtarbeit (20–6 Uhr) | bis 25 % | Grundlohn ≤ 50 €/Std. | Begünstigt nach § 3b EStG |
| Nachtarbeit (0–4 Uhr, Beginn vor 0 Uhr) | bis 40 % | Grundlohn ≤ 50 €/Std. | Erhöhte Belastung |
| Sonntagsarbeit | bis 50 % | Grundlohn ≤ 50 €/Std. | 0–24 Uhr |
| Feiertagsarbeit (gesetzlich) | bis 125 % | Grundlohn ≤ 50 €/Std. | 0–24 Uhr |
| 24./25./26. Dez., 1. Mai | bis 150 % | Grundlohn ≤ 50 €/Std. | Besonders begünstigt |
| Normale Überstunden (werktags) | – | – | Voll steuerpflichtig |
Übersteigt der Zuschlag oder der zugrunde liegende Stundenlohn diese Grenzen,
ist der übersteigende Teil steuerpflichtig.
| Steuerstatus | Sozialversicherung |
|---|---|
| Steuerfrei nach § 3b EStG | Beitragsfrei |
| Steuerpflichtig | Beitragspflichtig |
Die Sozialversicherung folgt grundsätzlich der steuerlichen Behandlung.
- § 3b Einkommensteuergesetz (EStG)
- R 3b Lohnsteuer-Richtlinien (LStR)
- § 14 Abs. 1 SGB IV
- BMF-Schreiben vom 17. 12. 2013 (BStBl I 2013, 1620)
| Zuschlag | Steuer | SV |
|---|---|---|
| Grundvergütung (normale Überstunden) | steuerpflichtig | beitragspflichtig |
| 25 % Nachtzuschlag | steuerfrei | beitragsfrei |
| 25 % normaler Überstundenzuschlag (tagsüber) | steuerpflichtig | beitragspflichtig |
Umsatzsteuer
📊 Umsatzsteuer – Grundlagen
Kompakter Überblick über steuerbare Umsätze, Bemessungsgrundlage, Befreiungen, Vorsteuer und Sonderregelungen.
1. Rechtsgrundlagen
- Umsatzsteuergesetz (UStG) als nationales Gesetz.
- Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MwStSystRL) der EU als Grundlage.
- Durchführung über Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung (UStDV).
2. Steuerbare Umsätze (§ 1 UStG)
- Lieferungen und sonstige Leistungen, die ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt ausführt.
- Eigenverbrauch (unentgeltliche Wertabgaben).
- Einfuhr aus dem Drittland & innergemeinschaftlicher Erwerb.
3. Ort der Leistung
Lieferungen: Ort, wo die Beförderung/Versendung beginnt.
Sonstige Leistungen: Grundsatz: Empfängerortprinzip (B2B) / Unternehmerortprinzip (B2C) mit Ausnahmen (Grundstücke, Personenbeförderung etc.).
4. Steuerbefreiungen (§ 4 UStG)
- Grundstücksumsätze (z. B. Vermietung, Verkauf unter Bedingungen).
- Leistungen im Gesundheitswesen.
- Schul- und Bildungsleistungen.
- Innergemeinschaftliche Lieferungen, Ausfuhrlieferungen.
5. Bemessungsgrundlage & Steuersätze
- Bemessungsgrundlage: Alles, was der Leistungsempfänger aufwendet, um die Leistung zu erhalten (ohne USt).
- Steuersätze: 19 % (Regelsatz), 7 % (ermäßigt, z. B. Lebensmittel, Bücher, ÖPNV).
6. Vorsteuerabzug (§ 15 UStG)
Unternehmer können die ihnen in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als Vorsteuer abziehen, soweit die Eingangsleistungen für steuerpflichtige Umsätze verwendet werden.
7. Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG)
- Umsatz im Vorjahr ≤ 22.000 € und im laufenden Jahr voraussichtlich ≤ 50.000 €.
- Keine USt-Ausweisung, kein Vorsteuerabzug.
- Option zur Regelbesteuerung möglich.
👉 Direkt testen im Kleinunternehmer-Check.
8. Reverse-Charge & Ausland
- Reverse-Charge: Leistungsempfänger schuldet die Steuer (z. B. Bauleistungen, Auslandssachverhalte).
- Innergemeinschaftliche Leistungen: Erwerbsteuer in DE, Vorsteuerabzug möglich.
- Drittlandsumsätze: Einfuhrumsatzsteuer beim Zoll.
Umsatzsteuer-Voranmeldung: Ablauf und Fristen
USt-Voranmeldung – Abgabefristen & Zahlung
Kurzüberblick für Fristen mit/ohne Dauerfristverlängerung
Regulär
Bis zum 10. Tag des Folgemonats
Mit Dauerfristverlängerung
Ein Monat später (z. B. statt 10. März → 10. April)
Zahlung
Zeitgleich mit der Abgabe überweisen oder per SEPA-Lastschrift einziehen lassen
ein SEPA-Lastschriftmandat hinterlegen – so werden Fristen automatisch eingehalten und
Säumniszuschläge vermieden.
👉 Alle Termine findest du auch in unserem
Steuerkalender.
Urlaubs- und Krankheitszeiten richtig dokumentieren
Urlaubs- und Krankheitszeiten richtig dokumentieren
Eine korrekte Dokumentation von Abwesenheiten ist entscheidend für die
Lohnabrechnung. Nur so können Urlaubsansprüche und Entgeltfortzahlung
fehlerfrei berücksichtigt werden.
Benötigte Unterlagen
- Urlaubsanträge – mit Genehmigung durch den Arbeitgeber
- Krankmeldungen – AU-Bescheinigung oder elektronische AU (eAU)
Praxis-Tipp
Reichen Sie Urlaubs- und Krankheitszeiten am besten digital ein (z. B. per Mitarbeiter-App oder
Online-Formular). So wird die Lohnabrechnung schneller und fehlerärmer.
Urlaubsabgeltung bei Austritt
Urlaubsabgeltung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses
Kann ein Arbeitnehmer seinen Resturlaub vor dem Austritt nicht mehr nehmen,
muss der Arbeitgeber diesen in Geld abgelten.
Grundlage ist § 7 Abs. 4 BUrlG.
1. Rechtsgrundlage
- § 7 Abs. 4 Bundesurlaubsgesetz (BUrlG): Urlaub ist abzugelten, wenn er wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr gewährt werden kann.
- Urlaubsabgeltung ist steuer- und sozialversicherungspflichtig wie laufender Arbeitslohn.
2. Berechnungsformel
Grundlage ist das durchschnittliche Arbeitsentgelt der letzten 13 Wochen vor Austritt (ohne Überstundenvergütung).
Formel:
Tagesvergütung = Monatsentgelt × 3 ÷ 13 ÷ Wochenarbeitstage
Urlaubsabgeltung = Tagesvergütung × Resturlaubstage
3. Beispielrechnung
Arbeitnehmer mit 3.000 € Monatsgehalt, 5-Tage-Woche und 5 Resturlaubstagen:
- Tagesvergütung = 3.000 × 3 ÷ 13 ÷ 5 ≈ 138 €
- Urlaubsabgeltung = 138 € × 5 = 690 € brutto
Hinweis: Bei schwankendem Einkommen sind die letzten 3 Monate vor Austritt maßgeblich.
Praktische Hinweise
- Rechtzeitig prüfen, ob Resturlaub genommen werden kann – das ist meist steuerlich günstiger.
- Abgeltung muss im letzten Gehalt mit ausgezahlt werden.
- Urlaubsabgeltung erhöht die Steuerprogression, da sie als Einmalzahlung gilt.
Diese Übersicht ersetzt keine individuelle Beratung. Bei Austritt empfiehlt sich die Rücksprache mit dem Steuerberater oder der Lohnbuchhaltung.
Urlaubsanspruch & Urlaubsabgeltung
Urlaubsanspruch & Urlaubsabgeltung
Jeder Arbeitnehmer hat Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub. Gesetz, Tarifverträge
und Arbeitsverträge können den Umfang regeln. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses
gibt es besondere Vorschriften zur Abgeltung von Resturlaub.
Auf einen Blick
24 Werktage Mindesturlaub (bei 6-Tage-Woche)
Umrechnung auf Arbeitstage je nach Arbeitszeitmodell
Auszahlung nur bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses
1. Gesetzlicher Mindesturlaub
- Nach dem Bundesurlaubsgesetz: 24 Werktage bei einer 6-Tage-Woche.
- Entspricht 20 Arbeitstagen bei einer 5-Tage-Woche.
- Vertraglich oder tariflich können mehr Urlaubstage vereinbart sein.
2. Teilurlaub
- Im ersten Halbjahr entsteht der volle Anspruch erst nach 6 Monaten Betriebszugehörigkeit.
- Vorher besteht ein anteiliger Anspruch (1/12 pro vollem Monat).
- Bei Ausscheiden in der ersten Jahreshälfte: nur anteiliger Anspruch.
3. Urlaub & Krankheit
- Erkrankt ein Arbeitnehmer während des Urlaubs, werden die Krankheitstage nicht angerechnet (ärztliches Attest erforderlich).
- Nicht genommener Urlaub kann bei lang andauernder Krankheit bis 15 Monate nach Ende des Urlaubsjahres übertragen werden.
4. Urlaubsabgeltung
- Urlaub soll grundsätzlich in natura genommen werden (Erholung).
- Auszahlung (Abgeltung) nur bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses möglich.
- Berechnung: Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen vor Ende des Arbeitsverhältnisses.
5. Praxis-Hinweise
- Urlaubsanspruch sollte im Betrieb transparent dokumentiert werden.
- Verfall: Grundsätzlich am 31.12., Übertrag ins Folgejahr nur in Ausnahmefällen (z. B. Krankheit oder dringende betriebliche Gründe).
- Arbeitgeber muss Beschäftigte aktiv auf ihren Resturlaub hinweisen (BAG-Rechtsprechung).
Verpflegungsmehraufwand
🍽️ Verpflegungsmehraufwand 2025/2026
Kanzlei-Wiki • Stand: Dezember 2025 (inkl. Auslandspauschalen lt. BMF-Schreiben vom 05.12.2025)
Arbeitnehmer:innen können für beruflich bedingte Auswärtstätigkeiten steuerfreie Verpflegungspauschalen erhalten (§ 9 Abs. 4a EStG). Gilt für Reisen, Dienstgänge, Baustellen- oder Kundeneinsätze außerhalb der ersten Tätigkeitsstätte.
Pauschalen gelten einheitlich auch für Arbeitgebererstattungen (LStR R 9.6).
| Abwesenheit | Pauschale | Hinweis |
|---|---|---|
| 24 Stunden | 28 € | Ganztägige Dienstreise |
| An-/Abreisetag (mit Übernachtung) | 14 € | Auch ohne 8-Stunden-Regel |
| Abwesenheit > 8 Stunden | 14 € | Eintägige Auswärtstätigkeit |
Seit 2020 unverändert. Nächste Anpassung durch BMF-Schreiben – Update folgt automatisch.
Pauschalen je Land/Ort werden jährlich per BMF-Schreiben festgelegt. Nachfolgende Werte sind Beispiele (Stand 2025). Maßgeblich sind immer die aktuellen Beträge laut BMF-Schreiben zu den Auslandstagegeldern (z.B. Schreiben vom 05.12.2025 für 2026).
Aktualisiert für 2026| Land | 24 Std | An-/Abreisetag |
|---|---|---|
| 🇦🇹 Österreich | 50 € | 33 € |
| 🇨🇭 Schweiz (ohne Bern) | 70 € | 47 € |
| 🇫🇷 Frankreich (Paris) | 58 € | 39 € |
| 🇮🇹 Italien (ohne Mailand + Rom) | 42 € | 28 € |
| 🇺🇸 USA (New York) | 66 € | 44 € |
Vollständige Ländertabelle im jeweiligen BMF-Schreiben (erscheint meist Ende November für das Folgejahr).
Pauschalen nur für die ersten 3 Monate derselben Auswärtstätigkeit am selben Ort. Danach kein Anspruch – Neustart erst nach Unterbrechung von mind. 4 Wochen.
| Zeitraum | Anspruch | Hinweis |
|---|---|---|
| 0–3 Monate | Ja | Pauschalen ansetzbar |
| > 3 Monate | Nein | Neustart nach > 4 Wochen Pause |
Wenn der Arbeitgeber Mahlzeiten stellt, ist die Pauschale zu kürzen – jeweils vom vollen 28-€-Tagessatz:
| Mahlzeit | Kürzung |
|---|---|
| Frühstück | 20 % = 5,60 € |
| Mittagessen | 40 % = 11,20 € |
| Abendessen | 40 % = 11,20 € |
Kürzungen pro Mahlzeit; Pauschale darf nicht negativ werden.
| Fall | Dauer | Pauschale | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Tagesreise (8–17 Uhr) | 9 Std | 14 € | Eintägige Dienstfahrt |
| 2-Tagesreise mit ÜN | 48 Std | 14 + 28 + 14 = 56 € | An-/Abreisetage + Zwischentag |
| Hotel inkl. Frühstück | 1 ÜN | 14 + (28 – 5,60) + 14 = 50,40 € | Kürzung für Frühstück |
- ✅ Reisedaten (Datum, Uhrzeit, Ort) dokumentieren
- ✅ Mahlzeiten vermerken & Kürzungen automatisieren
- 📋 3-Monatsfrist und Unterbrechungen prüfen
- 💡 Homeoffice ≠ Reise → keine Pauschale
- 🌍 Für Ausland: aktuelle BMF-Ländertabelle verwenden
| Punkt | Ergebnis |
|---|---|
| Inland | 28 € / 14 € (Stand 2025 / 2026) |
| Ausland | BMF-Ländertabelle (jährlich) |
| 3-Monatsfrist | Ja – Neustart nach > 4 Wochen |
| Mahlzeitenkürzung | 5,60 € / 11,20 € / 11,20 € |
Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 4a EStG, LStR R 9.6, BMF-Schreiben Reisekosten / Auslandstagegelder 2023 ff.
Öffnet den interaktiven Rechner für 2025/2026 – inkl. Kürzungen, CSV-Export & Druckfunktion.
Versicherungspflicht von Gesellschafter-Geschäftsführern
👔 Versicherungspflicht von Gesellschafter-Geschäftsführern
Kanzlei-Wiki • Stand: Oktober 2025
Die sozialversicherungsrechtliche Einordnung von Gesellschafter-Geschäftsführern (GGF) ist seit Jahren Gegenstand zahlreicher BSG- und BAG-Entscheidungen. Maßgeblich ist, ob eine abhängige Beschäftigung (§ 7 Abs. 1 SGB IV) oder eine selbstständige Tätigkeit vorliegt.
Die Abgrenzung erfolgt stets nach den tatsächlichen Verhältnissen, nicht allein nach Vertragstexten.
§ 1 SGB VI
BSG 13.07.2023 – B 12 R 11/21 R
BAG 21.12.2022 – 5 AZR 108/22
Zuständig für verbindliche Feststellungen ist die Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung Bund (§ 7a SGB IV).
- Beteiligungshöhe – Einfluss auf Gesellschafterbeschlüsse und Weisungsfreiheit
- Stimmrechte – Sperrminorität oder Gesamtvertretung entscheidend
- Tätigkeit im eigenen Unternehmen – unternehmerisches Risiko, Kapitalbeteiligung
- Vertragliche Bindung – feste Arbeitszeit, Urlaub, Entgeltfortzahlung → Indiz für Beschäftigung
- Faktische Weisungsgebundenheit – auch bei formaler Freiheit möglich
Die Gesamtabwägung entscheidet: Nur wenn der GGF aufgrund seiner Beteiligung oder Stellung maßgeblichen Einfluss auf die Geschicke der GmbH hat, gilt er als selbstständig.
| Konstellation | Status | Begründung / Urteil |
|---|---|---|
| Allein-Gesellschafter-GF | selbstständig | volle Einflussmöglichkeit, BSG 08.12.2021 – B 12 KR 37/19 R |
| GGF mit 50 % Beteiligung (paritätisch) | selbstständig | kann Beschlüsse blockieren; Weisungsfreiheit |
| Minderheits-GGF ohne Sperrminorität | versicherungspflichtig | BSG 19.09.2019 – B 12 R 25/18 R |
| Familien-GGF (z. B. Ehegatte, Kind) | abhängig vom Einfluss | BSG 11.11.2021 – B 12 KR 9/20 R: keine automatische Gleichbehandlung |
| Fremd-GF ohne Beteiligung | versicherungspflichtig | kein gesellschaftsrechtlicher Einfluss, BAG 21.12.2022 – 5 AZR 108/22 |
| „Strohmann-GF“ – faktisch gesteuert | versicherungspflichtig | BSG 31.03.2022 – B 12 R 5/20 R |
Entscheidend ist nicht die Bezeichnung im Vertrag, sondern die tatsächliche Einflussmöglichkeit im Betrieb.
- BSG 13.07.2023 – B 12 R 11/21 R: Keine Selbstständigkeit bei fehlender Sperrminorität – auch wenn faktisch Leitungstätigkeit vorliegt.
- BAG 21.12.2022 – 5 AZR 108/22: Arbeitsrechtlich und sozialversicherungsrechtlich kann der Status auseinanderfallen.
- BSG 08.12.2021 – B 12 KR 37/19 R: 50 %-GGF grundsätzlich selbstständig – bei faktischer Parität.
- BSG 19.09.2019 – B 12 R 25/18 R: Minderheits-GGF trotz Mitspracherecht sozialversicherungspflichtig.
- BSG 11.11.2021 – B 12 KR 9/20 R: Familienbeteiligung führt nicht automatisch zur Selbstständigkeit.
Tendenz der Rechtsprechung: Strengere Beurteilung zugunsten der Versicherungspflicht bei fehlender Sperrminorität.
- 📑 Gesellschaftsvertrag prüfen: Beteiligungsquote, Stimmrechte, Sperrminoritäten.
- 📋 GF-Vertrag prüfen: Arbeitszeit, Entgeltfortzahlung, Urlaubsregelung.
- 🏛️ Tatsächliche Einflussmöglichkeiten dokumentieren.
- 📬 Bei Unsicherheit: Statusfeststellungsverfahren (§ 7a SGB IV) beantragen.
- 🧾 Bei Änderungen (Gesellschafterwechsel, Kapitalerhöhung) erneut prüfen.
| Bereich | Empfehlung | Hinweis |
|---|---|---|
| Gesellschafteranteil < 50 % | Status prüfen | ggf. versicherungspflichtig |
| Sperrminorität | entscheidend | verhindert abhängige Beschäftigung |
| Familien-GGF | Einzelfall | nicht automatisch selbstständig |
| Kriterium | Ergebnis |
|---|---|
| Beteiligung ≥ 50 % / Sperrminorität | selbstständig |
| Minderheits-GGF ohne Sperrminorität | versicherungspflichtig |
| Familiengesellschaft | abhängig vom Einfluss |
| Fremd-GF | versicherungspflichtig |
| Statusfeststellung | Empfohlen bei jeder Neugründung / Änderung |
Kernbotschaft: Entscheidend ist die tatsächliche Einflussmöglichkeit, nicht die Bezeichnung im Vertrag.
Wann ist die Kleinunternehmerregelung sinnvoll?
Kleinunternehmerregelung (KUR) 2025
Wenn dein Umsatz im Vorjahr nicht über 25.000 € lag und im
laufenden Jahr voraussichtlich 100.000 € nicht übersteigt,
kannst du dich auf die Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG berufen.
Das spart Bürokratie – hat aber klare Grenzen.
Vorteile
- Keine Umsatzsteuer in Rechnungen ausweisen
- Keine USt-Voranmeldungen abgeben
- Weniger Verwaltungsaufwand
Nachteile
- Kein Vorsteuerabzug möglich
- Wirkt bei Geschäftskunden oft weniger professionell
- Grenzen müssen jährlich überwacht werden
Hinweis: Ob die KUR für dich sinnvoll ist, hängt
stark von deinen Investitionen (z. B. Anschaffungen mit Vorsteuer)
und deiner Zielgruppe (Privatkunden vs. Geschäftskunden) ab.
⚠️ Wichtig für Onlinehändler: Bei Leistungen von ausländischen Unternehmen
(z. B. Amazon, Stripe, Google Ads) greift oft das
Reverse-Charge-Verfahren (§ 13b UStG).
Dann schuldet du die Umsatzsteuer, hast aber als Kleinunternehmer
kein Recht auf Vorsteuerabzug – ein echter Nachteil!
👉 Prüfe deine individuelle Situation am besten mit unserem
Kleinunternehmer-Check.
Wann lohnt sich eine GmbH
WIKI: WANN LOHNT SICH EINE GMBH?
Vorteile, Nachteile & steuerliche Aspekte – interaktiv ohne JavaScript.
Kurzfazit: Für wen lohnt sich eine GmbH?
- Stabile Gewinne ab ~60–80 Tsd. €, nicht komplett privat benötigt.
- Reinvestitionen (Wachstum, Team, Maschinen, Marketing) geplant.
- Haftungsbegrenzung relevant.
- Mitgründer/Investoren oder spätere Anteilsübertragungen.
Einzelfälle immer individuell rechnen (Hebesatz, SV, Kirchensteuer, Privatbedarf).
Wann lohnt es sich eher nicht?
- Kleine/volatile Gewinne (<~60 Tsd. €).
- Gesamter Gewinn wird privat benötigt → Doppelbesteuerung nachteilig.
- Mehrkosten & Pflichten: Abschluss, Offenlegung, Beratung.
- Reine Freiberuflichkeit ohne Investitions-/Haftungsdruck.
Steuern im Überblick (GmbH vs. Privat)
| Ebene | GmbH | Einzelunternehmen / PersG |
|---|---|---|
| Unternehmenssteuer | KSt 15 % + Soli | ESt bis 45 % + Soli |
| Gewerbesteuer | Je nach Hebesatz (typ. 14–17 %) | Auch fällig; teils auf ESt anrechenbar |
| Thesaurierung | ~30 % Gesamtlast | Regelbesteuerung, ggf. § 34a EStG |
| Ausschüttung/Entnahme | 25 % KapESt (+ Soli/KiSt) oder TEV | Keine Zusatzsteuer |
| GF-Gehalt | Betriebsausgabe GmbH; privat LSt/SV | Entnahmen nicht lohnsteuerpflichtig |
Richtwerte – Effektivlast hängt u. a. von Hebesatz, SV-Status, Kirchensteuer ab.
Auszahlungswege: Gehalt vs. Ausschüttung
Gehalt (Geschäftsführung)
- Senkt GmbH-Gewinn → weniger KSt/GewSt.
- Privat Lohnsteuer + ggf. SV.
- Angemessenheit (Fremdvergleich) beachten.
Gewinnausschüttung
- GmbH-Gewinn bereits besteuert; Ausschüttung idR 25 % KapESt (+ Soli/KiSt).
- ≥ 1 % Beteiligung: Teileinkünfteverfahren (60 % steuerpfl.).
- Praxis: Mischung aus marktüblichem GF-Gehalt + Dividenden.
Laufende Kosten & Pflichten
- Jahresabschluss (Bilanz/GuV), E-Bilanz, Offenlegung (Bundesanzeiger).
- USt-Voranmeldungen, Lohnabrechnungen, Fristenmanagement.
- StB/WP-Kosten, ggf. Rechtsberatung; Notar/HR bei Änderungen.
- IHK-Beiträge.
Praxis-Checkliste vor der Gründung
- Business Case mit 3-Jahres-Plan (Gewinn, Invest, Privatbedarf).
- Hebesatz der Gemeinde prüfen & Standort wählen.
- GF-Gehalt realistisch (Liquidität, Markt, Fremdvergleich).
- Payout-Strategie (Gehalt/Ausschüttung) festlegen.
- Risikoprofil & Versicherungen (Betriebs-/VSH) prüfen.
- Optional: Holding bei Beteiligungen/Exit prüfen.
Beispielrechnungen: Thesaurieren vs. Ausschütten
Case A: Reinvestition
Gewinn 120.000 € → ~30 % Unternehmenssteuern ≈ 36.000 € → ~84.000 € verbleiben für Investitionen.
Case B: Voll ausschütten
~84.000 € nach Steuern → Ausschüttung (25 % KapESt + Soli) ⇒ Netto grob ~63.000–64.000 € (ohne KiSt/TEV).
Grobe Richtwerte; Details variieren (Hebesatz, KiSt, SV, Gehalt/Dividenden-Mix).
Mini-Rechner: schneller Gefühlstest
FAQ: häufige Fragen zur GmbH
GmbH oder UG (haftungsbeschränkt)?
UG ist günstiger zu starten (1 € möglich), aber mit Thesaurierungspflicht bis 25.000 € Stammkapital. GmbH wirkt solider.
Ist eine Holding sinnvoll?
Bei Beteiligungserwerben/-verkäufen oder Exit kann eine Holding deutliche Vorteile bringen; Setup/Administration komplexer.
Wie schnell gründen?
Musterprotokoll ist schnell; individueller Vertrag (mehrere Gesellschafter, Vesting) oft sinnvoller.
Was bedeutet eigentlich OSS?
WIKI: WAS ONLINEHÄNDLER ÜBER OSS WISSEN MÜSSEN
One-Stop-Shop (OSS) für eCommerce – Pflichten, Chancen & Praxis. Mit direktem Link zum OSS-Rechner.
Kurzfazit: Was ist OSS?
- One-Stop-Shop ist ein EU-Verfahren für B2C-Fernverkäufe.
- Statt in jedem Zielland registrieren → eine zentrale Meldung im Sitzstaat.
- Gilt für Waren (Fernverkäufe) und bestimmte digitale Dienstleistungen.
- Schwelle: EU-weit 10.000 € Jahresumsatz (B2C).
Wird die Schwelle überschritten → Pflicht zur OSS-Nutzung oder lokalen Registrierung im Zielland.
Für wen gilt OSS konkret?
- Onlinehändler mit Kunden in der EU (B2C).
- Digitale Anbieter (E-Books, Software, Streaming, Onlinekurse).
- Plattform-Verkäufer, wenn sie selbst als Lieferant gelten (außer Marktplatz schuldet Steuer).
B2B-Umsätze fallen nicht unter OSS → hier greifen die bekannten Reverse-Charge-Regeln.
Vorteile von OSS
✅ Weniger Bürokratie
- Keine Mehrfachregistrierungen in allen EU-Ländern.
- Eine Meldung im Sitzstaat reicht.
✅ Einheitliche Prozesse
- Quartalsweise Meldung über ein Portal.
- Zentrale Zahlung an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt).
✅ Planungssicherheit
- Steuersätze aller EU-Länder im Überblick.
- Leichte Integration in Shop- oder Buchhaltungssysteme.
Nachteile & Stolperfallen
- Keine Vorsteuererstattung über OSS – dafür weiterhin lokale Registrierungen nötig.
- Warenlager im Ausland (z. B. Amazon FBA) → zusätzliche USt-Registrierung vor Ort bleibt Pflicht.
- Fristen & Datenqualität: OSS-Meldungen müssen pünktlich & korrekt sein, Korrekturen sind aufwendig.
Typische Fehler: falsche Steuersätze, fehlende OSS-Anmeldung, Vermischung von B2B/B2C.
Praxis-Checkliste für Händler
Zur Berechnung der Schwelle und Steuersätze: Zum OSS-Rechner → jetzt ausprobieren.
FAQ: häufige Fragen zu OSS
Wie melde ich mich zum OSS an?
In Deutschland über das BZStOnline-Portal. Anmeldung vor Quartalsbeginn.
Gilt OSS auch für digitale Leistungen?
Ja, z. B. Downloads, Streaming oder Online-Kurse. Ort der Leistung = Wohnsitz des Kunden.
Brauche ich trotz OSS noch andere USt-Registrierungen?
Ja, sobald du Warenlager in anderen EU-Ländern nutzt oder Vorsteuer dort geltend machen willst.
Was ist bei Anzahlungsrechnungen zu beachten?
Anzahlungsrechnungen richtig stellen
Bei Anzahlungen entsteht die Umsatzsteuer bereits
im Zeitpunkt der Zahlung – nicht erst mit der Lieferung oder Leistung.
Deshalb gelten besondere Regeln für die Rechnungstellung.
Wichtige Punkte
- Anzahlungsrechnung immer mit ausgewiesener Umsatzsteuer stellen
- Bei Zahlung: Umsatzsteuer sofort in der USt-Voranmeldung anmelden und abführen
- Schlussrechnung: erhaltene Anzahlungen (netto + USt) separat aufführen und abziehen
- Nur der Restbetrag wird dann noch mit Umsatzsteuer belastet
Beispiel
Ein Bauunternehmer verlangt für eine Leistung von insgesamt 10.000 € netto
eine Anzahlung von 30 %.
- Anzahlungsrechnung: 3.000 € netto + 570 € USt = 3.570 € brutto
- Zahlung erfolgt: USt von 570 € muss direkt ans Finanzamt gemeldet werden
- Schlussrechnung: 10.000 € netto
– 3.000 € netto Anzahlung = 7.000 € netto + 1.330 € USt = 8.330 € brutto
Anzahlungs- und Schlussrechnung.
👉 Mit unserem Vorsteuer-Rechner
kannst du die Beträge für Anzahlungen und Schlussrechnung einfach prüfen.
Was ist bei Austritten von Mitarbeitern zu beachten?
→ Kündigungsdatum, Resturlaub, Überstunden, Abfindungen, Rückgabe von Firmeneigentum. Abmeldung bei Krankenkasse und Finanzamt wird von uns gemacht
Was ist eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR)?
Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR)
Die Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) ist die einfachste Form der Gewinnermittlung
für kleine und mittlere Unternehmen, Freiberufler und Selbständige.
Sie basiert auf dem Zufluss-/Abflussprinzip:
Entscheidend ist, wann Geld tatsächlich geflossen ist.
Grundprinzip
Bei der EÜR werden alle Betriebseinnahmen den Betriebsausgaben gegenübergestellt.
Der Überschuss ergibt den steuerpflichtigen Gewinn.
- Betriebseinnahmen: alle Zahlungen, die dem Unternehmen zufließen (z. B. Kundenrechnungen, Zuschüsse).
- Betriebsausgaben: alle Zahlungen, die abfließen (z. B. Miete, Material, Versicherungen, Löhne).
- Zufluss-/Abflussprinzip: Einnahmen und Ausgaben werden im Jahr berücksichtigt, in dem sie tatsächlich gezahlt wurden.
Beispielrechnung
Ein Freiberufler im Jahr 2025:
- Betriebseinnahmen: 50.000 € (Rechnungen von Kunden, tatsächlich bezahlt)
- Betriebsausgaben: 20.000 € (Miete, Bürobedarf, Versicherungen)
Gewinn = 50.000 € – 20.000 € = 30.000 €
Typische Fehlerquellen
- Rechnungen gebucht, aber nicht bezahlt: zählen nicht als Einnahmen/Ausgaben, solange kein Geld geflossen ist.
- Privatanteile vergessen: z. B. bei Kfz-Kosten oder Telefon.
- Investitionen falsch erfasst: Wirtschaftsgüter über 800 € netto müssen abgeschrieben werden.
- Kassenbuch nicht geführt: Bargeldbewegungen müssen vollständig dokumentiert werden.
💡 Tipp: Nutze eine digitale Buchhaltungssoftware oder DATEV-Schnittstelle.
Damit wird die EÜR automatisch erstellt und du sparst viel Zeit bei der Steuererklärung.
| Kriterium | EÜR | Bilanzierung |
|---|---|---|
| Pflicht für | Kleinunternehmer, Freiberufler | Kapitalgesellschaften, größere Betriebe |
| Komplexität | ⭐⭐ (einfach) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (hoch) |
| Aufwand | ⭐⭐ (gering) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (hoch) |
| Transparenz | ⭐⭐⭐ (mittel) | ⭐⭐⭐⭐ (hoch) |
| Steuerliche Anerkennung | ausreichend | umfassend |
| Rechtliche Grundlage | § 4 Abs. 3 EStG | HGB + AO (§§ 140 ff. AO) |
Was muss ich beachten beim Austritt eines Arbeitnehmers
Arbeitnehmer-Austritt – Offboarding in der Praxis
Was ist bei Kündigung/Beendigung zu tun? Kompakt: Fristen, Meldungen, Zahlungen, Dokumente.
Kernschritte
- Termine klären: Zugang Kündigung, letzter Arbeitstag, Resturlaub/Abgeltung.
- Letzte Abrechnung: Urlaub, Überstunden, offene Posten einbeziehen.
- Meldungen: DEÜV-Abmeldung an die Krankenkasse; eAB an die Agentur für Arbeit.
- Zeugnis: einfach oder qualifiziert, zeitnah erstellen.
- Rückgabe/Zugänge: Hardware, Schlüssel, Karten; IT-Sperren & Weiterleitung (DSGVO-konform).
Fristen & Hinweise
- Urlaubsabgeltung: mit der letzten Abrechnung auszahlen.
- DEÜV-Abmeldung: zum Ende der Beschäftigung (Grund 30) übermitteln.
- Sofortmeldung entfällt bei Austritt (nur beim Eintritt relevant).
- Lohnsteuerbescheinigung: regulär zum Jahresende elektronisch; unterjährig i. d. R. keine separate.
- Aufbewahrung: Personalakte nach gesetzlichen Fristen archivieren.
Dokumente & Bescheinigungen
- Arbeitszeugnis (einfach/qualifiziert)
- Urlaubsbescheinigung (für neuen Arbeitgeber)
- Elektronische Arbeitsbescheinigung (eAB) an Agentur für Arbeit
- Bescheinigungen zu bAV / VL (falls vorhanden)
- Übergabeprotokoll Rückgaben (Schlüssel, IT, Fahrzeug, Karten)
FAQ (kurz)
Wann muss Urlaubsabgeltung gezahlt werden?
Mit der letzten Lohnabrechnung; Grundlage ist der noch offene Anspruch zum Austrittsdatum.
Bekommt man eine Lohnsteuerbescheinigung beim Austritt?
Regelmäßig erst nach Jahresende (elektronisch). Bei Arbeitgeberwechsel dient die Urlaubsbescheinigung als Nachweis des bereits genommenen Urlaubs.
Was passiert, wenn ich eine Frist versäume?
Was passiert, wenn eine Frist versäumt wird?
Wird eine Steuererklärung nicht rechtzeitig abgegeben, hat das Finanzamt verschiedene
Möglichkeiten: Verspätungszuschläge, Zinsen und notfalls
eine Schätzung.
1. Verspätungszuschläge (§ 152 AO)
- Bei verspäteter Abgabe wird automatisch ein Zuschlag festgesetzt, wenn die Erklärung mehr als
14 Monate nach Jahresende eingeht (bei Beraterfristen: 19 Monate). - Höhe: 0,25 % der festgesetzten Steuer pro angefangenem Monat der Verspätung,
mindestens 25 € pro Monat. - Maximaler Zuschlag: 25.000 €.
- Ausnahmen: kein Zuschlag, wenn die Steuer Null oder negativ ist oder die Vorauszahlungen alles abdecken.
2. Nachzahlungszinsen (§ 233a AO)
Für Steuernachzahlungen erhebt das Finanzamt Zinsen, wenn seit Ablauf des Jahres
mehr als 15 Monate vergangen sind:
- 0,15 % pro Monat (= 1,8 % pro Jahr).
- Berechnung: Steuerbetrag × 0,0015 × Anzahl Monate.
3. Schätzungsbefugnis (§ 162 AO)
Wird die Erklärung trotz Erinnerung nicht abgegeben, darf das Finanzamt die Besteuerungsgrundlagen
schätzen. Meist fällt die Schätzung ungünstiger aus, um Druck auf die Abgabe auszuüben.
Beispiel
Einkommensteuer 2023 von 8.000 €, Abgabefrist bis 31.08.2024.
Erklärung wird erst im Februar 2025 eingereicht (6 Monate Verspätung).
Verspätungszuschlag: 0,25 % × 8.000 € × 6 Monate = 120 € (mindestens 25 €/Monat).
Praxis-Tipp
Bitte melden Sie sich rechtzeitig, falls Sie merken, dass eine Frist nicht eingehalten werden kann.
Oft ist eine Fristverlängerung möglich. Damit lassen sich Zuschläge und Zinsen vermeiden.
Was sind Rückstellungen und wofür brauche ich sie?
Rückstellungen – Überblick
Definition
Rückstellungen sind Verbindlichkeiten für ungewisse Verpflichtungen.
Ihre Höhe und/oder Fälligkeit ist noch unklar, aber wahrscheinlich.
Sie werden im Jahresabschluss berücksichtigt.
Beispiele
- Ausstehende Rechnungen
- Urlaubsansprüche
- Prozessrisiken
- Steuernachzahlungen
Wirkung
Rückstellungen mindern den Gewinn des laufenden Jahres
und belasten damit schon heute das Ergebnis.
Bilanzierung
Rückstellungen erscheinen auf der Passivseite der Bilanz
und stellen zukünftige Belastungen dar.
da sie zukünftige Belastungen schon heute berücksichtigen.
Welche Belege gehören in die Buchhaltung?
Welche Belege gehören in die Buchhaltung?
Für eine ordnungsgemäße Buchführung müssen alle geschäftlich relevanten Belege
vollständig und nachvollziehbar aufbewahrt und erfasst werden.
Kernbelege
- Eingangsrechnungen (Einkäufe, Dienstleistungen)
- Ausgangsrechnungen (an Kunden)
- Kassenbelege & Quittungen
- Bankauszüge & Kreditkartenabrechnungen
Zusatzbelege
- Bewirtungsbelege (immer mit Anlass & Teilnehmern!)
- Reisekostenbelege (Fahrten, Hotel, Verpflegung)
- Verträge (Miet-, Leasing-, Darlehensverträge)
- Sonstige Nachweise (z. B. Zollbelege, Steuerbescheide)
und eine Zahlung oder Nutzung dokumentiert, gehört in die Buchhaltung.
👉 Unser Tipp: Lade alle Belege zeitnah in
DATEV Unternehmen online hoch –
so ist deine Buchführung jederzeit prüfungssicher.
Welche Daten brauchen Sie bei einer Neueinstellung?
Unterlagen für die Lohnbuchhaltung
Für eine reibungslose Abwicklung der Lohn- und Gehaltsabrechnung benötigen wir von jedem neuen Mitarbeiter bestimmte Unterlagen.
Eine vollständige Erfassung ist wichtig, um Sozialversicherung, Lohnsteuer und gesetzliche Vorgaben korrekt zu erfüllen.
1. Grundunterlagen
- Arbeitsvertrag mit allen wesentlichen Vereinbarungen.
- Eintrittsdatum (erster Arbeitstag).
- Bankverbindung für die Gehaltsüberweisung.
2. Steuer- & Sozialversicherung
- Steuer-Identifikationsnummer (Steuer-ID).
- Sozialversicherungsnummer (Rentenversicherungsausweis).
- Krankenkasse (Mitgliedsbescheinigung).
- ggf. ELStAM-Angaben (Steuerklasse, Kinderfreibeträge, Kirchensteuer).
3. Besondere Unterlagen (falls zutreffend)
- Schwerbehindertenausweis (für Steuerermäßigungen und Zusatzurlaub).
- Bescheinigungen zu Minijob/Midijob oder Hauptbeschäftigung.
- Nachweise für vermögenswirksame Leistungen (VL-Verträge).
4. Tipps für die Praxis
- Alle Unterlagen am besten vor Arbeitsbeginn einreichen.
- Fehlende Angaben können zu falschen Abzügen oder Rückfragen der Krankenkassen führen.
- Unterlagen digital erfassen und in einer Mitarbeiterakte speichern.
- Bei Änderungen (z. B. Krankenkassenwechsel, Steuerklassenwechsel) zeitnah melden.
Lohnbuchhaltung – schnelle Orientierung
- Grunddaten: Arbeitsvertrag, Eintrittsdatum, Bankverbindung
- Steuer & SV: Steuer-ID, SV-Nummer, Krankenkasse
- Besonderheiten: Schwerbehindertenausweis, VL-Verträge
Welche Daten brauchen Sie bei einer Neueinstellung?
Arbeitnehmer anmelden – Check & Ablauf
Welche Angaben/Dokumente benötige ich und welche Meldungen müssen raus? Kompakt im Überblick.
Kurz-Checkliste – Angaben für die Anmeldung
- 🔹 Arbeitsvertrag (mit Beginn, Tätigkeit, Arbeitszeit, Vergütung)
- 🔹 Steuer-ID & Geburtsdatum (für ELStAM-Abruf)
- 🔹 Sozialversicherungsnummer
- 🔹 Krankenkasse (Mitgliedsbestätigung)
- 🔹 Eintrittsdatum
- 🔹 IBAN (Bankverbindung)
- 🔹 Anschrift & Kontaktdaten
- 🔹 Beschäftigungsart (Voll/Teilzeit, Minijob, Werkstudent, Azubi)
- 🔹 Lohnart (Stundenlohn/Festgehalt, Zuschläge)
- 🔹 Steuerliche Merkmale per ELStAM (Klasse, Kirche, Kinderfreib.)
- 🔹 Berufsgenossenschaft (BG-Zweig, falls nötig Gefahrtarifstelle)
- 🔹 Notfallkontakt (optional)
Tipp: Lass dir fehlende Angaben mit einem kurzen Personal-Stammblatt abfragen.
Pflichtschritte im Ablauf
- ELStAM abrufen (elektronische Lohnsteuermerkmale) mit Steuer-ID, Geburtsdatum und Beschäftigungsbeginn.
- Sozialversicherung anmelden (DEÜV-Meldung) an die gewählte Krankenkasse.spätestens mit der nächsten Entgeltabrechnung, max. 6 Wochen nach Beginn
- Sofortmeldung vor Arbeitsaufnahme, falls Branche mit Sofortmeldepflicht:
Bau, Gastgewerbe, Personenbeförderung, Spedition/Logistik, Schausteller, Gebäudereinigung, Fleischwirtschaft, Prostitution. - Minijob? Anmeldung zusätzlich bei der Minijob-Zentrale (Rentenversicherungspflicht beachten; ggf. Befreiungsantrag).
- Unfallversicherung: Mitarbeiter der zuständigen Berufsgenossenschaft zuordnen.
- Betriebliche Umlagen (AAG/U1/U2) laufen über die Krankenkasse – korrekte Umlagesätze im Lohnsystem hinterlegen.
- Bank & Stammdaten im Lohnprogramm anlegen; Personalakte anlegen/ergänzen.
Je nach Fall zusätzlich
- ➡️ Aufenthaltstitel/Arbeitserlaubnis (Nicht-EU)
- ➡️ Schwerbehindertenausweis (Ausgleichsabgabe/Urlaub)
- ➡️ Werkstudent/Student: Studienbescheinigung, Statusprüfung
- ➡️ Azubi: Ausbildungsvertrag, Eintragung HWK/IHK
- ➡️ Dienstwagen/Firmenfahrrad: Nutzungsvereinbarung
- ➡️ BAV (Entgeltumwandlung): Versorgungsordnung & Anmeldung
Für die Personalakte
- 🗂️ Unterzeichneter Arbeitsvertrag (Probezeit, Arbeitszeit, Vergütung)
- 🗂️ Belehrung Datenschutz/IT-Nutzung (DSGVO-Hinweise, Art. 13)
- 🗂️ Nachweis Arbeitszeitregeln (z. B. Zeiterfassung, Pausen)
- 🗂️ Urlaubsanspruch & ggf. Arbeitszeitkonto-Vereinbarung
- 🗂️ Einwilligungen (Foto/Website, Notfallkontakt – freiwillig)
Fristen & Pflichten
- ⏱️ Sofortmeldung (in den o. g. Branchen) vor Arbeitsaufnahme.
- ⏱️ DEÜV-Anmeldung spätestens mit der nächsten Entgeltabrechnung, spätestens 6 Wochen nach Beginn.
- ⏱️ Minijob-Zentrale zeitnah, zusammen mit der ersten Abrechnung.
- ⏱️ ELStAM-Abruf idealerweise vor der ersten Lohnabrechnung.
Mini-FAQ
Gibt es eine separate „Checkliste“?
Mit obiger Kurz-Checkliste deckst du alles Wichtige ab. Wenn du magst, kann ich dir daraus eine druckbare 1-Seiten-Version bauen (Stammblatt + Häkchenliste).
Minijob – Rentenversicherungspflicht?
Ja, grundsätzlich pflichtig. Befreiung ist auf Antrag des Mitarbeiters möglich (schriftliche Erklärung in die Personalakte).
Welche Fristen gelten für die Lohnabrechnung?
Fristen für die Lohnabrechnung
Damit Löhne und Gehälter korrekt und pünktlich abgerechnet werden können, sind bestimmte
Fristen einzuhalten – sowohl für die Auszahlung an die Mitarbeiter als auch für die
Abgaben an Sozialversicherungsträger und Finanzamt.
- Abrechnungszeitraum: Üblicherweise zum Monatsende oder Monatsanfang.
- Sozialversicherung: Beiträge müssen spätestens am drittletzten Bankarbeitstag
des laufenden Monats gemeldet und gezahlt sein. - Lohnsteuer: Abzuführen bis zum 10. des Folgemonats.
- Personaländerungen: (Ein- und Austritte, Adress- und Bankdaten, Krankmeldungen etc.)
bitte spätestens bis zum 20. des laufenden Monats mitteilen.
Tipp: Je früher uns die Änderungen vorliegen,
desto reibungsloser läuft die Abrechnung – und unnötige Korrekturen oder Säumniszuschläge werden vermieden.
Welche Unterlagen brauche ich für die USt-Voranmeldung?
Unterlagen für die Buchführung
Für eine ordnungsgemäße Buchführung müssen alle relevanten Belege und Unterlagen vollständig übergeben werden.
Eine saubere Vorbereitung erleichtert die Verarbeitung und vermeidet Rückfragen bei der Finanzbuchhaltung.
1. Wichtige Unterlagen
- Eingangsrechnungen: alle Lieferanten- und Dienstleisterbelege des Monats/Quartals.
- Ausgangsrechnungen: sämtliche Kundenrechnungen inkl. Gutschriften.
- Kassenberichte: tägliche Aufzeichnungen bei Barzahlungen, Kassenbuch.
- Bankauszüge: alle Geschäftskonten, inkl. Kreditkartenabrechnungen.
- Zahlungsdienste: PayPal, Stripe, Klarna oder andere Zahlungsanbieter mit Monatsübersicht.
2. Besonderheiten
- Innergemeinschaftliche Erwerbe: Rechnungen aus EU-Ländern mit korrekter USt-IdNr.
- Reverse-Charge-Leistungen: Leistungen von ausländischen Dienstleistern (Steuerschuldnerschaft beachten).
- Gutscheine & Anzahlungen: Besonderheiten bei der Umsatzsteuer berücksichtigen.
3. Tipps für die Praxis
- Alle Belege digitalisieren und strukturiert ablegen (z. B. nach Monaten).
- Bank- und Zahlungsdienst-Auszüge regelmäßig exportieren.
- Barbelege sofort erfassen, um Lücken in der Kasse zu vermeiden.
- Besonderheiten (z. B. Auslandsgeschäfte) direkt kennzeichnen, um Rückfragen zu vermeiden.
Buchführung – schnelle Orientierung
- Alle Rechnungen, Kassenberichte, Bank- & Zahlungsdienste erfassen
- Besonderheiten: innergemeinschaftliche Erwerbe & Reverse-Charge
- Digitale Ablage spart Zeit & erleichtert die Prüfung
👉 Noch einfacher: Nutze unsere
Checkliste zur Buchführung
– damit keine Unterlage mehr fehlt.
Welche Unterlagen brauchen Sie für einen Praktikanten?
Welche Unterlagen brauchen Sie für einen Praktikanten?
Bei der Anmeldung von Praktikanten sind einige Unterlagen erforderlich.
Wichtig: Der Status (Pflichtpraktikum oder freiwilliges Praktikum) beeinflusst
die sozialversicherungs- und steuerrechtliche Behandlung.
Checkliste Unterlagen
- Praktikumsvertrag (mit Dauer, Aufgaben, Vergütung, Arbeitszeit)
- Zeitraum des Praktikums (Start- und Enddatum)
- Angabe zur Vergütung (vergütet oder unentgeltlich)
- Schul- oder Studiennachweis (Immatrikulationsbescheinigung, Schulbescheinigung)
- Statusnachweis: Pflichtpraktikum oder freiwilliges Praktikum
- Sozialversicherungsnummer (falls bereits vorhanden)
- Steuer-ID (nur bei vergüteten Praktika relevant)
- Krankenversicherung (Name + Nachweis der Versicherung)
- Bankverbindung (für Gehaltszahlungen, falls Vergütung)
Hinweis
Bei Pflichtpraktika während Schule oder Studium fallen in der Regel
keine Sozialversicherungsbeiträge an.
Bei freiwilligen Praktika gilt dagegen eine volle SV- und Steuerpflicht
– ähnlich wie bei regulären Arbeitnehmern.
Daher ist die Unterscheidung besonders wichtig.
Welche Unterlagen werden für den Jahresabschluss benötigt?
Unterlagen für den Jahresabschluss
Für den Jahresabschluss müssen verschiedene Unterlagen zusammengestellt werden.
Eine vollständige und gut vorbereitete Übergabe spart Zeit und Kosten und verhindert Rückfragen des Finanzamts.
1. Wichtige Unterlagen
- Inventur: Aufstellung aller Bestände zum Bilanzstichtag.
- Offene Posten: Debitoren- und Kreditorenlisten (offene Kunden- und Lieferantenrechnungen).
- Verträge: Darlehen, Leasing-, Miet- und sonstige relevante Verträge.
- Anlagenverzeichnis: Übersicht über Anlagegüter inkl. Abschreibungen.
- Rückstellungen: z. B. für ausstehende Rechnungen, Urlaubstage, Gewährleistungen.
2. Tipps für die Praxis
- Frühzeitig alle Unterlagen sammeln – am besten schon unterjährig.
- Digitale Ablage nutzen → erleichtert Übergabe und spart Papier.
- Checklisten abarbeiten, damit nichts vergessen wird.
- Rückstellungen immer mit Belegen / Berechnungen dokumentieren.
Jahresabschluss – schnelle Orientierung
- Inventur, offene Posten, Verträge, Anlagenverzeichnis, Rückstellungen
- Frühzeitige Vorbereitung spart Zeit & Kosten
- Checklisten nutzen für Vollständigkeit
👉 Noch einfacher: Nutze unsere
Checkliste zum Jahresabschluss
– kompakt und praxiserprobt.
Welche Vorteile hat die digitale Belegführung?
Vorteile der digitalen Buchführung
Digitale Buchführung spart nicht nur Zeit und Papier, sondern sorgt auch für eine
effiziente Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Steuerkanzlei.
Über DATEV Unternehmen online
können Belege direkt hochgeladen und rechtssicher archiviert werden.
Schneller Zugriff
Belege jederzeit online verfügbar – auch mobil. Kein langes Suchen in Ordnern mehr.
Weniger Papier
Digitale Ablage ersetzt das klassische Pendelordner-System.
Spart Platz, Druckkosten und ist nachhaltiger.
Revisionssicher
Archivierung nach den GoBD-Vorgaben:
unveränderbar, vollständig und jederzeit nachvollziehbar.
Direkte Übergabe
Alle Belege fließen automatisch in die Kanzlei-Software ein –
für eine schnelle und fehlerfreie Weiterverarbeitung.
prüfungssicher ist, muss sie den GoBD entsprechen.
👉 Unterstütze deine Abläufe mit unserem
GoBD-Tool.
Welche Vorteile hat die digitale Lohnakte?
Welche Vorteile hat die digitale Lohnakte?
Mit der digitalen Lohnakte werden alle relevanten Unterlagen zur Lohnabrechnung
sicher und zentral archiviert. Arbeitgeber und Mitarbeiter sparen dadurch Zeit, Papier und Nerven.
Vorteile im Überblick
- Zentraler Zugriff auf Abrechnungen, Meldungen, Verträge
- Revisions- & prüfungssicher nach GoBD
- Sichere digitale Archivierung statt Papierordner
- Schnelle Suche & einfaches Teilen von Dokumenten
- Kostensparend – weniger Papier, Druck & Lagerung
Praxis-Tipp
Die digitale Lohnakte ist besonders praktisch in Kombination mit
DATEV Arbeitnehmer online.
Mitarbeiter können ihre Unterlagen jederzeit selbst abrufen – das spart Rückfragen und
Entlastet die Personalabteilung.
Welche Zahlungsarten sollte ich trennen (Bar, Karte, PayPal etc.)?
Welche Zahlungsarten sollte ich trennen?
Für eine saubere Buchführung und korrekte Umsatzsteuer ist es wichtig,
Zahlungsarten getrennt zu erfassen. So werden Abweichungen schneller sichtbar
und Betriebsprüfungen einfacher.
Wichtige Zahlungsarten
- Barzahlungen – täglich im Kassenbuch erfassen
- EC-/Kreditkartenzahlungen – nach Kartenterminal-Abrechnungen buchen
- PayPal / Stripe / Online-Payment – Kontoauszüge des Zahlungsanbieters verwenden
- Banküberweisungen – direkt vom Geschäftskonto übernehmen
Tipp aus der Praxis
Lege für jede Zahlungsart ein eigenes Buchungskonto oder einen separaten Bericht an.
So lassen sich Einnahmen besser abgleichen – zum Beispiel Bargeld vs. Bankeinzahlungen
oder PayPal-Konto vs. Shop-Umsätze.
Werbungskosten
Werbungskosten (Arbeitnehmer) – schnelle Orientierung
- Pauschale: 1.230 € pro Jahr (wird automatisch berücksichtigt)
- Fahrtkosten: Pendlerpauschale, ÖPNV-Tickets, Jobrad
- Arbeitsmittel: PC, Handy, Fachliteratur, Bürobedarf
- Reisekosten: Verpflegungspauschalen, Übernachtung, Fahrtkosten
- Weitere Aufwendungen: Fortbildung, Gewerkschaftsbeiträge, doppelte Haushaltsführung
Hinweis: Übersteigen die tatsächlichen Werbungskosten die Pauschale von 1.230 €, lohnt sich das Sammeln von Belegen.
Werbungskosten Arbeitnehmer
|
ℹ️
Wichtiger Hinweis:
Dieses Wiki dient der allgemeinen Orientierung. Es ersetzt keine individuelle steuerliche Beratung. Für eine persönliche Einschätzung sprich uns jederzeit direkt an. WIKI: Werbungskosten für ArbeitnehmerWelche Kosten kannst du als Arbeitnehmer:in steuerlich geltend machen – und wann lohnt sich mehr als die Pauschale von 1.230 €? Werbungskosten sind alle Aufwendungen, die durch den Beruf veranlasst sind. Jeder Arbeitnehmer hat automatisch eine Pauschale von 1.230 € pro Jahr (ab 2023). Höhere tatsächliche Kosten können steuermindernd geltend gemacht werden.
🧮 Mini-Rechner: Lohnt sich mehr als die Pauschale?
Geschätzte Steuerersparnis insgesamt: 0 €
Davon Mehrersparnis gegenüber der Pauschale (1.230 €): 0 € Vereinfachte Beispielrechnung – individuelle Effekte (Progression, andere Abzüge) bleiben unberücksichtigt.
👉 Praktisch: Mit unserem Pendlerpauschale-Rechner kannst du deine Entfernungspauschale direkt berechnen.
Achtung:
Erstattet der Arbeitgeber Reisekosten, können diese nicht zusätzlich als Werbungskosten angesetzt werden.
Steuertipp:
Führe über das Jahr eine einfache Liste (z. B. Excel/Notiz-App) mit Datum, Art der Ausgabe und Betrag.
So hast du zur Steuererklärung alles griffbereit.
Hinweis: Diese Übersicht ersetzt keine individuelle Steuerberatung – sie hilft dir, deine Unterlagen strukturiert vorzubereiten. Kurzberatung zu deinen Werbungskosten anfragen📞
Unsicher, welche Kosten du ansetzen kannst?
Wir prüfen deine Werbungskosten im Detail und zeigen dir, was sich steuerlich wirklich lohnt. |
Wie entlasse ich Mitarbeiter?
Wie entlasse ich einen Mitarbeiter?
Eine Kündigung ist rechtlich und menschlich heikel. Damit du sicher und professionell vorgehst, hier die wichtigsten Schritte:
1. Vorab prüfen
- Kündigungsgrund klären: verhaltensbedingt, personenbedingt, betriebsbedingt.
- Kündigungsschutz prüfen: Gilt das Kündigungsschutzgesetz (mehr als 10 Mitarbeiter / länger als 6 Monate Beschäftigung)?
- Besonderer Schutz: Schwangere, Elternzeit, Schwerbehinderte, Betriebsrat.
💡 Tipp: Ohne klaren Kündigungsgrund droht eine Kündigungsschutzklage.
2. Formelle Voraussetzungen
- Schriftform: Kündigung muss immer schriftlich erfolgen.
- Unterschrift: Eigenhändig durch Arbeitgeber oder Bevollmächtigten.
- Zugang sichern: Persönliche Übergabe oder Zustellung per Boten.
3. Fristen beachten
- Gesetzliche Kündigungsfristen nach § 622 BGB.
- Arbeits-/Tarifvertrag prüfen (abweichende Fristen möglich).
- Sonderkündigungen: Probezeit oder außerordentliche Kündigung.
4. Gespräch mit dem Mitarbeiter
Kündigung immer persönlich und respektvoll mitteilen, Gründe sachlich erläutern und Raum für Fragen geben.
5. Nach der Kündigung
- Arbeitszeugnis erstellen.
- Resturlaub / Überstunden regeln.
- Sozialversicherung & Finanzamt abmelden.
- Bescheinigungen aushändigen (z. B. Urlaubsbescheinigung).
Checkliste für Arbeitgeber
- ✅ Kündigungsgrund geprüft
- ✅ Kündigungsschutzgesetz berücksichtigt
- ✅ Schriftform & Unterschrift eingehalten
- ✅ Frist beachtet
- ✅ Kündigung persönlich übergeben
- ✅ Zeugnis & Bescheinigungen erstellt
- ✅ Meldungen an Sozialversicherung erfolgt
Praktische Hinweise
- Eine Abfindung kann helfen, Streit zu vermeiden.
- Alternativ: Aufhebungsvertrag, wenn beide Seiten zustimmen.
- Bei Unsicherheit rechtliche Beratung einholen.
Diese Übersicht ersetzt keine individuelle Beratung. Im Zweifel: Rücksprache mit Anwalt oder Fachanwalt.
Wie erkenne ich, ob eine Rechnung alle Pflichtangaben enthält?
Pflichtangaben auf Rechnungen
- Name und Anschrift des Ausstellers und des Empfängers
- Steuernummer oder USt-IdNr. des Ausstellers
- Ausstellungsdatum der Rechnung
- Fortlaufende Rechnungsnummer (eindeutig, ohne Lücken)
- Menge und Art der gelieferten Gegenstände bzw. Art & Umfang der Leistung
- Nettobetrag (Entgelt ohne USt)
- Umsatzsteuersatz (z. B. 19 % / 7 %) und Umsatzsteuerbetrag in €
- Bruttobetrag (Endbetrag inkl. USt)
vereinfachte Angaben ausreichend (u. a. keine Steuernummer/USt-IdNr., aber Name/Anschrift, Datum, Art/Menge, Bruttobetrag und USt-Satz erforderlich).
Wichtige Sonderfälle (Zusatzvermerke):
-
Reverse-Charge (Leistung an Unternehmer mit § 13b UStG):
Zusatz auf der Rechnung:
„Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (Reverse-Charge)“.
Umsatzsteuer nicht ausweisen. -
Innergemeinschaftliche Lieferung (Waren in anderes EU-Land):
Zusatz:
„Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung“;
USt-IdNr. beider Parteien angeben. -
Ausfuhrlieferung (Export):
Zusatz:
„Steuerfreie Ausfuhrlieferung nach § 4 Nr. 1 a i. V. m. § 6 UStG“. -
Steuerfreie Umsätze (z. B. Heilbehandlung, Vermietung):
Zusatz:
„Umsatz steuerfrei – Befreiungstatbestand: § … UStG“
(konkrete Norm angeben); keine USt ausweisen. -
Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG):
Zusatz:
„Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.“ -
Gutschrift (Self-Billing):
Rechnung muss das Wort „Gutschrift“ enthalten und die
USt-IdNr./Steuernummer des Leistungserbringers; übrige Pflichtangaben wie oben.
Praxis-Tipp: Verwende Textbausteine in deinem Rechnungsprogramm für die obigen Vermerke, um Fehler zu vermeiden.
Wie führe ich ein Fahrtenbuch richtig?
Wie führe ich ein Fahrtenbuch richtig?
Ein Fahrtenbuch muss zeitnah, lückenlos und manipulationssicher geführt werden.
Es dient dem Finanzamt als Nachweis, wie hoch der Anteil der betrieblichen Nutzung am Firmenwagen ist.
- Jede Fahrt sofort eintragen: zeitnah nach Fahrtbeginn bzw. -ende.
- Pflichtangaben: Datum, Start- & Zielort,
Kilometerstände (Anfang/Ende) und Zweck der Fahrt. - Privatfahrten: eindeutig als „privat“ kennzeichnen.
- Geschäftsfahrten: mit Kunde, Projekt oder Anlass dokumentieren.
- Tank- und Werkstattfahrten: ebenfalls aufnehmen.
Praxis-Tipps
- Elektronische Fahrtenbücher sind erlaubt, wenn sie GoBD-konform sind
(keine nachträglichen Änderungen möglich). - Belege aufbewahren: Tankquittungen, Werkstattrechnungen und Leasingverträge
helfen bei der Plausibilitätsprüfung. - Konsistenz prüfen: Kilometerstände sollten mit Inspektions- und HU-Belegen übereinstimmen.
Hinweis: Ob sich ein Fahrtenbuch für dich lohnt, hängt von
Fahrleistung, Privatanteil und Fahrzeugwert ab.
👉 Nutze unseren
Rechner: 1%-Regelung vs. Fahrtenbuch, um die günstigste Variante zu ermitteln.
Wie funktioniert der Vorsteuerabzug?
Wie funktioniert der Vorsteuerabzug?
Unternehmen können die in Eingangsrechnungen enthaltene Umsatzsteuer
als Vorsteuer von ihrer eigenen Umsatzsteuerschuld abziehen.
Damit mindert sich die Zahllast an das Finanzamt.
Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug
- Ordnungsgemäße Rechnung nach § 14 UStG
- Leistung für das Unternehmen (betriebliche Veranlassung)
- Kein Ausschluss (z. B. bestimmte Pkw-Kosten, Bewirtungen über 70 %, Geschenke über 35 €)
Pflichtangaben auf einer Rechnung
- Name und Anschrift von Aussteller und Empfänger
- Steuernummer oder USt-IdNr. des Ausstellers
- Ausstellungsdatum und fortlaufende Rechnungsnummer
- Menge und Art der Lieferung bzw. Art und Umfang der Leistung
- Nettobetrag, Steuersatz, Umsatzsteuerbetrag und Bruttobetrag
über 1.000 € netto + 190 € USt.
→ Er darf die 190 € als Vorsteuer abziehen und mit seiner eigenen Umsatzsteuerzahllast verrechnen.
👉 Berechne deine Vorsteuer ganz einfach mit unserem
Vorsteuer-Rechner.
Wie gehe ich mit Barbelegen um?
Barbelege richtig erfassen
Barbelege (z. B. Tankquittungen, Restaurantbelege, kleine Ausgaben) müssen
zeitnah und vollständig erfasst werden, um bei einer Betriebsprüfung
anerkannt zu werden.
- Beleg sichern: Jeden Barbeleg sofort fotografieren oder einscannen.
- Datum & Zweck: Auf dem Beleg das Zahlungsdatum und den
geschäftlichen Anlass notieren. - Upload in DUO: Beleg in
DATEV Unternehmen online hochladen. - Kassenführung: Bei Bargeldkassen täglich einen Kassenbericht erstellen
und ein Zählprotokoll ablegen.
Beispiel: Kassenbuchblatt
| Datum | Beleg-Nr. | Einnahme | Ausgabe | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | 001 | – | 25,00 € (Tankbeleg) | 975,00 € |
| 01.01.2025 | 002 | 150,00 € (Barverkauf) | – | 1.125,00 € |
👉 So könnte ein Kassenbuchblatt aussehen – wichtig: jeden Tag mit
Anfangs- und Endbestand sowie einem Zählprotokoll abschließen.
Tipp: Lade Barbelege möglichst am selben Tag hoch und
führe dein Kassenbuch lückenlos – so bleibt es prüfungssicher.
Wie gehe ich mit Eigenbelegen um (z. B. Trinkgeld, Verlustbelege)?
Wie gehe ich mit Eigenbelegen um?
Eigenbelege ersetzen fehlende Rechnungen nur im Ausnahmefall.
Sie dienen als Ersatznachweis für Ausgaben, wenn keine ordnungsgemäße Rechnung erhältlich ist
– z. B. bei Trinkgeld, Verlust von Belegen oder Parkautomaten ohne Quittung.
Inhalt eines Eigenbelegs
- Datum der Ausgabe
- Betrag
- Anlass / Zweck
- Ort der Ausgabe
- Beteiligte Personen (falls relevant)
- Unterschrift des Ausstellers
Wichtiger Hinweis
Eigenbelege sind nicht gleichwertig zu Rechnungen und sollten nur
ausnahmsweise eingesetzt werden.
Lade sie in DUO oder dein DMS hoch wie einen normalen Beleg – aber setze sie sparsam ein.
Praxis-Tipp
Für wiederkehrende Fälle (Trinkgeld, Parkgebühren) lohnt es sich, ein
Eigenbeleg-Formular vorzubereiten, das nur noch ausgefüllt werden muss.
Wie lade ich Belege in DATEV Unternehmen online hoch?
Belege in DATEV Unternehmen online hochladen
Belege hochladen in DATEV Unternehmen online – so geht’s Schritt für Schritt.
Mit dieser Anleitung laden Sie Belege, Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen und Quittungen schnell und sicher in
DATEV Unternehmen online (DUO) hoch – direkt im Browser oder per App, ganz ohne Zusatzprogramme wie Belegtransfer.
Ideal für Unternehmen, die ihre Buchhaltung digital und revisionssicher organisieren möchten.
Schritt-für-Schritt · Web (Drag & Drop)
- Anmeldung: https://duo.datev.de mit SmartCard oder SmartLogin.
- Belege → Belege hochladen öffnen.
- Dateien hochladen: PDF/JPG/PNG per Drag & Drop ins Fenster ziehen oder „Dateien auswählen“.
- Prüfen: Datum, Rechnungsnummer, Betrag, MwSt. müssen gut lesbar sein.
- Bereitstellen: Nach dem Upload stehen die Belege automatisch der Kanzlei zur Verfügung.
Upload per App (mobil)
- DATEV Upload mobil installieren (iOS/Android) und mit SmartLogin koppeln.
- Beleg fotografieren → Zweck/Kategorie wählen → hochladen.
- Tipp: Fotografiere auf kontrastreichem Hintergrund, vermeide Schatten/Schrägen.
Ordnung & Geschwindigkeit (Best Practices)
- Sammel-Uploads: Mehrere Dateien gleichzeitig hochladen.
- Ordner nutzen: „Eingangsrechnungen“, „Ausgangsrechnungen“, „Kasse“ – hält es übersichtlich.
- OCR bevorzugen: PDFs mit Texterkennung verbessern Trefferquoten.
- Laufend statt schubweise: Belege zeitnah hochladen, nicht erst zum Monatsende.
Prüfen Sie mit dem DUO Monats-Check (Ampel + Freigabe), ob Belege, Bank (und ggf. Kasse) vollständig sind.
0-Euro-Rechnungen (Null-Betrag) – was tun?
- Immer hochladen: Auch 0-€-Rechnungen archivieren (Aufbewahrungspflicht).
- Belegnotiz ergänzen: Kurz den Grund nennen (z. B. Probe/Gratislieferung, Gutschrift/Storno, Werbeleistung ohne Entgelt, interne Umlage).
- Steuerkennzeichen wählen (nie leer lassen):
- steuerfrei (§ 4 UStG) – wenn gesetzliche Befreiung vorliegt,
- 0 % USt – steuerbar, aber Steuersatz 0 %,
- nicht steuerbar – reiner Innenumsatz/Gratisprobe (ggf. unentgeltliche Wertabgabe prüfen).
- Belege anhängen: Lieferschein, Export-/Versandnachweis oder interne Freigabe beifügen.
- Gutschriften/Storno: Originalrechnung in der Notiz referenzieren („Bezug auf RE 123 vom 10.10.2025“).
Kopierbare Notizen:
- „Probe/Gratislieferung – kein Entgelt vereinbart. Lieferschein Nr. … beigefügt.“
- „Gutschrift zu RE … (Datum …) – Korrektur, Nettobetrag 0,00 €.“
- „Werbeleistung ohne Entgelt – keine Berechnung, Nachweis angehängt.“
- „Unentgeltliche Wertabgabe – steuerlich prüfen; Beleg / Freigabe anbei.“
Häufige Fragen (FAQ)
Upload geht nicht – was tun?
Browser wechseln (Chrome/Edge), Cache leeren, PDF „als Kopie speichern“. SmartLogin-Verbindung prüfen.
Kann ich Belege löschen?
Bereits bereitgestellte Belege lassen sich nicht „entfernen“, aber mit Vermerken korrigieren oder durch neue Versionen ersetzen.
Welche Formate sind erlaubt?
PDF, JPG, PNG. Empfohlen: PDF mit OCR.
Für eine saubere Zusammenarbeit mit der Buchhaltung empfehlen wir unsere
Checkliste „Welche Belege braucht die Buchhaltung?“.
Wie lange dauert die Erstellung des Jahresabschlusses?
→ Abhängig von Vollständigkeit der Unterlagen. Wenn alles digital vorliegt, in der Regel wenige Wochen. Frühzeitige Lieferung beschleunigt die Bearbeitung.
Wie lange müssen Belege aufbewahrt werden?
Aufbewahrungsfristen für Unterlagen
Unternehmer sind verpflichtet, geschäftliche Unterlagen für bestimmte Zeiträume
aufzubewahren. Diese Fristen sind im Handelsgesetzbuch (HGB) und in der
Abgabenordnung (AO) geregelt. Verstöße können bei einer Betriebsprüfung
teuer werden.
1. 10 Jahre
- Buchungsbelege (Kassenbelege, Kontoauszüge, Eingangs-/Ausgangsrechnungen)
- Jahresabschlüsse (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Inventare)
- Steuerbescheide, Steuererklärungen & Prüfungsberichte
2. 6 Jahre
- Geschäftsbriefe (Handels- und Geschäftsbriefe, E-Mails mit steuerlicher Relevanz)
- Verträge, soweit sie für die Besteuerung relevant sind
- Unterlagen zur Personalverwaltung, soweit keine längere Frist greift
3. Besonderheiten & Tipps
- Fristbeginn: immer am Ende des Kalenderjahres, in dem die Unterlage entstanden ist.
- Beispiel: Rechnung vom 15.06.2024 → Aufbewahrung bis 31.12.2034.
- Bei laufenden Verfahren (z. B. Steuerprüfung) verlängern sich die Fristen automatisch.
- Digitale Archivierung im DUO-System empfohlen → erfüllt die GoBD-Anforderungen und ist revisionssicher.
Aufbewahrungsfristen – schnelle Orientierung
- 10 Jahre: Rechnungen, Buchungsbelege, Jahresabschlüsse, Steuerunterlagen
- 6 Jahre: Geschäftsbriefe, E-Mails, Verträge
- Tipp: Digital archivieren (z. B. DUO) → GoBD-konform & jederzeit verfügbar
Hinweis: Diese Übersicht ersetzt keine individuelle Beratung.
Im Zweifel lieber länger aufbewahren, um Ärger mit dem Finanzamt zu vermeiden.
Wie reiche ich Reisekosten richtig ein?
Wie reiche ich Reisekosten richtig ein?
Damit Reisekosten steuerlich anerkannt und korrekt in der Buchhaltung erfasst werden,
ist eine vollständige und nachvollziehbare Dokumentation notwendig.
Neben den Belegen sind immer auch Zweck, Datum und Reisedaten anzugeben.
Was gehört in die Reisekostenabrechnung?
- Reisezweck (z. B. Kundentermin, Messebesuch, Schulung)
- Reisedatum und Dauer (von/bis)
- Gefahrene Strecke (Start- und Zielort, km bei Pkw-Fahrten)
- Belege für alle Aufwendungen:
- Hotelrechnungen
- Flugtickets / Bahnfahrkarten
- Taxi- und ÖPNV-Belege
- Park- und Mautquittungen
- Bewirtungsbelege (mit Anlass & Teilnehmern)
- Verpflegungsmehraufwand nach den gültigen Pauschalen (ohne Beleg, aber mit Zeitangaben)
So reichst du die Reisekosten ein
- Alle Belege sammeln (digital oder Papier).
- Belege mit Zweck, Datum und Strecke ergänzen.
- Scans/Fotos in
DATEV Unternehmen online hochladen. - Falls notwendig: kurze Aufstellung oder Tabelle beifügen (z. B. für mehrere Fahrten).
(z. B. in einer App oder Notiz) – so stellst du sicher, dass keine Fahrt und kein Beleg verloren geht.
👉 Eine eigene Checkliste für Reisekosten können wir gerne noch erstellen.
Wie werden innergemeinschaftliche Lieferungen behandelt?
Lieferung an Unternehmer mit gültiger USt-ID in der EU ist in Deutschland steuerfrei. Voraussetzungen: Gelangensnachweis, korrekte Rechnungsangaben, Meldung in der ZM.